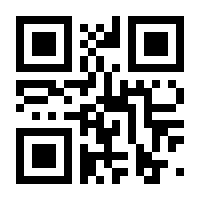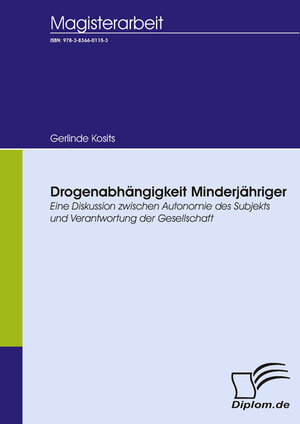
×
![Buchcover ISBN 9783836601153]()
Drogenabhängigkeit Minderjähriger - eine Diskussion zwischen Autonomie des Subjekts und Verantwortung der Gesellschaft
von Gerlinde KositsMotivation für die vorliegende Arbeit war die in der eigenen Berufstätigkeit oft erlebte Hilflosigkeit und Ohnmacht angesichts schwer drogenabhängiger Jugendlicher, die im Rahmen der Jugendwohlfahrt sozialpädagogisch betreut wurden und werden. Unter den gegebenen rechtlichen wie institutionellen Rahmenbedingungen erweist es sich immer wieder als ineffizient und unzureichend, dieser Klientel dieselbe Struktur zu bieten wie anderen schutz- und hilfebedürftigen, verwahrlosten und entwicklungsgestörten Minderjährigen. Vielfach wurde und wird – auch von der zuständigen Hierarchie – beklagt, dass manifest Süchtige eine Randgruppe darstellen, deren Betreuung aufgrund ihrer speziellen Problematik nicht nur mühsam und frustrierend ist, in der Erfolge höchstens kleinschrittweise erwartbar sind, sondern auch für andere heimuntergebrachte Jugendliche eine Gefährdung in ihrer ohnehin vorhandenen Labilität darstellen; spezialisierte Einrichtungen im sozialpädagogischen Betreuungsbereich gibt es deswegen aber nicht.
Infolge eines Versorgungsauftrags durch das Wiener Jugendwohlfahrtsgesetz 1990 (§37 – aus diesem ist der Versorgungsauftrag nach derzeitiger Rechtsauslegung erschließbar) gelangen solche Heranwachsenden, deren Verbleib im familiären Kreis nicht möglich ist und die zu keiner Therapie bereit sind, jedoch ebenfalls in die vorhandenen Einrichtungen der öffentlichen Heimunterbringung (für private Träger wie auch diverse Sonderprojekte ist Drogenabhängigkeit eher ein Ausschließungs- als Aufnahmegrund).
Österreichweit existieren keine geschlossenen Institutionen der Jugendwohlfahrt, und auch in der Psychiatrie sind die Auflagen für eine Einweisung gegen den Willen der mündigen Patienten (diese Mündigkeit wird mit 14 Jahren angenommen – ABGB §146c) recht rigide. So sie also nicht auch aus den vorhandenen Heimen und Stationen entweichen und ein Leben auf der Straße oder in wechselnden Unterkünften vorziehen, bleiben sie Thema für dieses Arbeitsfeld.
Angesichts dieser Lage wird immer wieder der Ruf nach geschlossenen Einrichtungen bzw. Möglichkeiten der Zwangstherapie laut – eine Option, die in vorliegender Arbeit abseits vorschneller moralingeschwängerter Vorbehalte und in aller Vorsicht und Sorgsamkeit auf ethischer Grundlage untersucht werden soll; es soll nicht darum gehen, jeden Jugendlichen, der sich im Laufe seiner Adoleszenz durch welche Mittel auch immer einen Rausch zufügt, sofort strafweise einzusperren; vielmehr wird hier Geschlossenheit im Sinne von strukturvermittelnd und haltgebend verstanden, die für jene, die so tief in ihrer Abhängigkeit stecken, dass sie abseits der Sucht keinen relevanten realen Bezugspunkt in ihrem Leben mehr haben, einen Schutz und Rahmen für eine positive Entwicklungsmöglichkeit darstellen soll.
Die Literaturlage zu diesem speziellen Thema ist äußerst dünn – während zu den Gebieten der Suchtprophylaxe und den freiwillig anzunehmenden Therapieangeboten wie auch medizinischen Abhandlungen zu Drogenwirkung, Suchtgenese und Entzug kein Mangel herrscht, gibt es zur Reflexion einer verpflichtenden Behandlung für minderjährige manifest abhängige Süchtige so gut wie nichts. In neuester Zeit unterstützen immerhin Überlegungen zur verstärkten Wiederaufnahme von Erziehungsverantwortung die hier vorliegenden Gedankengänge. Aufgrund des Mangels (sozial-)pädagogischer Auseinandersetzung mit der Behandlung und Betreuung schwerst drogenabhängiger Minderjähriger werden hier vielfach Beiträge, die sich mit psychiatrischen, therapeutischen, medizinischen Aspekten v. a. in Verknüpfung mit ethischer Argumentation befassen, miteinbezogen.
Im Gegensatz zu anderen stark diskutierten Themen der ethischen Auseinandersetzung geht es hier nicht um Rechtfertigung von Tötung wie etwa in der Debatte um Abtreibung, Euthanasie oder Sterbehilfe, sondern um die Absicht der Ermöglichung eines gesünderen Lebens, allerdings unter Einschluss von Zwangsmaßnahmen – Hilfe wider Willen quasi. Derzeit wird ja im Namen der Autonomie und Mündigkeit Freiwilligkeit und intrinsische Behandlungsmotivation für die Aufnahme in einer Drogeneinrichtung verlangt, egal ob ambulant oder stationär, Substitutionsprogramm oder Abstinenztherapie, harm reduction oder sonstiges in einem grundsätzlich stark differenzierten Angebotsfeld; auch der Hinweis auf ein maturing out etwa im dritten oder vierten Lebensjahrzehnt fußt auf der Grundannahme, dass sich die Problematik über Selbstregulierung im Laufe der Zeit auflöst – es stellt sich aber die Frage, ob Jugendliche damit nicht prinzipiell überfordert sind und – ethisch gesprochen -, ob Autonomie ein Konstituens des Menschlichen ist oder ein Ideal, dem man sich im Zuge der Entwicklung asymptotisch anzunähern bestrebt sein sollte.
Mit Verweis auf das Menschenrecht der Freiheit und der Verwehrung des Zugriffs auf das Privatleben wird jeglicher Zwang abgelehnt – allerdings sind soziale Sicherheit, der Genuss wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Rechte für die Erlangung der Würde und freien Entwicklung der Persönlichkeit ebenfalls Menschenrechte; auf den Anspruch besondere Fürsorge und Unterstützung von Kindern wird eigens hingewiesen, ebenso auf die „gerechten Anforderungen der Moral“. Die Problematik der Debatte hängt wohl auch damit zusammen, dass das Erkennen und Ausüben von Schadensvermeidung leichter ist als jenes der aktiven Hilfestellung. Nach Leist ist Nichtschaden eine vollkommene Pflicht, weil immer klar ist, wann sie gilt, während Helfen eine unvollkommene Pflicht darstellt, die dem Spielraum der Interpretation unterworfen ist.
Nicht zuletzt aufgrund historischer Ereignisse ist die Diskussion um Zwang in der Erziehung und angrenzenden Feldern emotionsgeladen und mit Vorbehalten behaftet. Geschehenes in Bausch und Bogen zu verurteilen, spricht jedoch mehr für eine Abwehr und Verdrängung als für eine gründliche Aufarbeitung und fundierte differenzierte Beurteilung der damaligen Mittel und Ziele.
Während der erste Teil der vorliegenden Arbeit ein grundlegendes Verständnis der zentralen Begriffe und Prozesse erarbeiten will, bezieht sich der zweite darauf aufbauend auf den Kern der ethischen Auseinandersetzung in Form einer Grundsatzdiskussion über Autonomie und Verantwortung in Hinblick auf die Frage des Zwangskontextes für manifest drogenabhängige Minderjährige.
Infolge eines Versorgungsauftrags durch das Wiener Jugendwohlfahrtsgesetz 1990 (§37 – aus diesem ist der Versorgungsauftrag nach derzeitiger Rechtsauslegung erschließbar) gelangen solche Heranwachsenden, deren Verbleib im familiären Kreis nicht möglich ist und die zu keiner Therapie bereit sind, jedoch ebenfalls in die vorhandenen Einrichtungen der öffentlichen Heimunterbringung (für private Träger wie auch diverse Sonderprojekte ist Drogenabhängigkeit eher ein Ausschließungs- als Aufnahmegrund).
Österreichweit existieren keine geschlossenen Institutionen der Jugendwohlfahrt, und auch in der Psychiatrie sind die Auflagen für eine Einweisung gegen den Willen der mündigen Patienten (diese Mündigkeit wird mit 14 Jahren angenommen – ABGB §146c) recht rigide. So sie also nicht auch aus den vorhandenen Heimen und Stationen entweichen und ein Leben auf der Straße oder in wechselnden Unterkünften vorziehen, bleiben sie Thema für dieses Arbeitsfeld.
Angesichts dieser Lage wird immer wieder der Ruf nach geschlossenen Einrichtungen bzw. Möglichkeiten der Zwangstherapie laut – eine Option, die in vorliegender Arbeit abseits vorschneller moralingeschwängerter Vorbehalte und in aller Vorsicht und Sorgsamkeit auf ethischer Grundlage untersucht werden soll; es soll nicht darum gehen, jeden Jugendlichen, der sich im Laufe seiner Adoleszenz durch welche Mittel auch immer einen Rausch zufügt, sofort strafweise einzusperren; vielmehr wird hier Geschlossenheit im Sinne von strukturvermittelnd und haltgebend verstanden, die für jene, die so tief in ihrer Abhängigkeit stecken, dass sie abseits der Sucht keinen relevanten realen Bezugspunkt in ihrem Leben mehr haben, einen Schutz und Rahmen für eine positive Entwicklungsmöglichkeit darstellen soll.
Die Literaturlage zu diesem speziellen Thema ist äußerst dünn – während zu den Gebieten der Suchtprophylaxe und den freiwillig anzunehmenden Therapieangeboten wie auch medizinischen Abhandlungen zu Drogenwirkung, Suchtgenese und Entzug kein Mangel herrscht, gibt es zur Reflexion einer verpflichtenden Behandlung für minderjährige manifest abhängige Süchtige so gut wie nichts. In neuester Zeit unterstützen immerhin Überlegungen zur verstärkten Wiederaufnahme von Erziehungsverantwortung die hier vorliegenden Gedankengänge. Aufgrund des Mangels (sozial-)pädagogischer Auseinandersetzung mit der Behandlung und Betreuung schwerst drogenabhängiger Minderjähriger werden hier vielfach Beiträge, die sich mit psychiatrischen, therapeutischen, medizinischen Aspekten v. a. in Verknüpfung mit ethischer Argumentation befassen, miteinbezogen.
Im Gegensatz zu anderen stark diskutierten Themen der ethischen Auseinandersetzung geht es hier nicht um Rechtfertigung von Tötung wie etwa in der Debatte um Abtreibung, Euthanasie oder Sterbehilfe, sondern um die Absicht der Ermöglichung eines gesünderen Lebens, allerdings unter Einschluss von Zwangsmaßnahmen – Hilfe wider Willen quasi. Derzeit wird ja im Namen der Autonomie und Mündigkeit Freiwilligkeit und intrinsische Behandlungsmotivation für die Aufnahme in einer Drogeneinrichtung verlangt, egal ob ambulant oder stationär, Substitutionsprogramm oder Abstinenztherapie, harm reduction oder sonstiges in einem grundsätzlich stark differenzierten Angebotsfeld; auch der Hinweis auf ein maturing out etwa im dritten oder vierten Lebensjahrzehnt fußt auf der Grundannahme, dass sich die Problematik über Selbstregulierung im Laufe der Zeit auflöst – es stellt sich aber die Frage, ob Jugendliche damit nicht prinzipiell überfordert sind und – ethisch gesprochen -, ob Autonomie ein Konstituens des Menschlichen ist oder ein Ideal, dem man sich im Zuge der Entwicklung asymptotisch anzunähern bestrebt sein sollte.
Mit Verweis auf das Menschenrecht der Freiheit und der Verwehrung des Zugriffs auf das Privatleben wird jeglicher Zwang abgelehnt – allerdings sind soziale Sicherheit, der Genuss wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Rechte für die Erlangung der Würde und freien Entwicklung der Persönlichkeit ebenfalls Menschenrechte; auf den Anspruch besondere Fürsorge und Unterstützung von Kindern wird eigens hingewiesen, ebenso auf die „gerechten Anforderungen der Moral“. Die Problematik der Debatte hängt wohl auch damit zusammen, dass das Erkennen und Ausüben von Schadensvermeidung leichter ist als jenes der aktiven Hilfestellung. Nach Leist ist Nichtschaden eine vollkommene Pflicht, weil immer klar ist, wann sie gilt, während Helfen eine unvollkommene Pflicht darstellt, die dem Spielraum der Interpretation unterworfen ist.
Nicht zuletzt aufgrund historischer Ereignisse ist die Diskussion um Zwang in der Erziehung und angrenzenden Feldern emotionsgeladen und mit Vorbehalten behaftet. Geschehenes in Bausch und Bogen zu verurteilen, spricht jedoch mehr für eine Abwehr und Verdrängung als für eine gründliche Aufarbeitung und fundierte differenzierte Beurteilung der damaligen Mittel und Ziele.
Während der erste Teil der vorliegenden Arbeit ein grundlegendes Verständnis der zentralen Begriffe und Prozesse erarbeiten will, bezieht sich der zweite darauf aufbauend auf den Kern der ethischen Auseinandersetzung in Form einer Grundsatzdiskussion über Autonomie und Verantwortung in Hinblick auf die Frage des Zwangskontextes für manifest drogenabhängige Minderjährige.