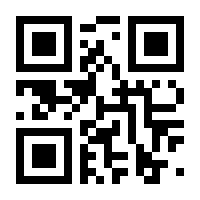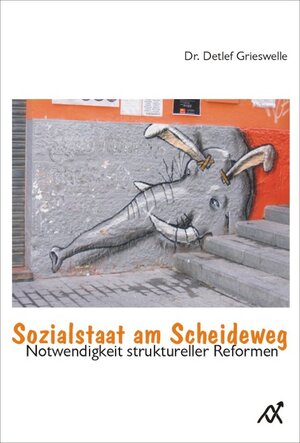
×
![Buchcover ISBN 9783929304558]()
Jeder interessierte Staatsbürger, der alternative Vorstellungen zur heutigen Sozialpolitik reflektieren will.
Einführung
I. Enttabuisierung und Rationalität in öffentlichen Diskursen. Voraussetzungen für sozialpolitische Strukturreformen
1. Tabus in der öffentlichen Meinung 2. Forderung der politischen Korrektheit 3. Druck der veröffentlichten Meinung und rationaler Diskurs 4. Nation und Leitkultur 5. Leistungsschwächen in der Bundesrepublik Deutschland 6. Sozialer Wandel und demographischer Diskurs 7. Bevölkerung und Bevölkerungspolitik 8. Lebensformen 9. Innere Einheit und Ostdeutschland 10. Politische Korrektheit für Minderheiten und Randständige 11. Erörterung der Frage der Zuwanderung 12. Globalisierungsdiskurs 13. Ergebnis
II. Neue Kultur des Sozialstaats. Prinzipien und Leitbilder gegen Reformstau
1. Eigenverantwortung in solidarischer Ordnung 2. Bürgergesellschaft als umfassendes Leitbild politischer Gestaltung 3. Gerechtigkeit zwischen den Generationen 4. Entstaatlichung, Deregulierung und Flexibilisierung 5. Entfaltung der Humanressourcen 6. Gestaltungsprinzip der Prävention 7. Integration von Randgruppen und Hilfen für sozial Schwache
III. Gegenwärtige Reformpolitik und notwendige Entscheidungen. Grundlegender Wandel sozialpolitischer Gestaltung
1. Erneuerung der gesetzlichen Krankenversicherung 2. Umgestaltung der gesetzlichen Rentenversicherung 3. Neuordnung der gesetzlichen Pflegeversicherung 4. Reform der gesetzlichen Arbeitslosenversicherung und der Arbeitslosen- und Sozial-hilfe
IV. Durchsetzung von Reformen durch Eliten. Verbesserung der Strategien und institutionellen Rahmenbedingungen
1. Leistung der Eliten 2. Abbau von Besitzständen 3. Perspektiven und Argumente für Reformen
V. Gefährdung der Demokratie? Demokratische Tradition und Zusammenhalt des Gemeinwesens
Anmerkungen
Heute wird man nicht umhin kommen, festzustellen, dass das gesamte politische System in Deutschland bezüglich grundlegender struktureller Reformen in der Vergangenheit weitgehend versagt hat, vor allem bei der Erneuerung des Sozialstaats, aber auch in vielen anderen Fel-dern wie Wirtschaft, Bildung, Forschung usf. Es ist heute zu einem großen Problemstau gekommen, der vor dem Hintergrund gewachsener Einstellungen, Verhaltensweisen und institutioneller Regelungen von den politischen Akteuren nur mit großen Schwierigkeiten abzubauen ist, vor allem, was die Begründung, Durchsetzung und Akzeptanz sozialpolitischer Innovationen angeht. Es fällt insbesondere schwer, die Reformen als unabdingbare Veränderungen plausibel zu machen und bei der Bevölkerung den Eindruck zu erwecken, dass die Umgestaltung des Sozialstaats auch als Chance zu begreifen ist. Welche kollosalen Meinungskämpfe die Strukturreformer gegen jene, die eine kurzatmige, kurzfristige und nur partielle Reformen ins Auge fassende Politik betrieben haben, heute bestreiten müssen, zeigen die doch recht zurückhaltenden Reformen bzw. Reformansätze von Ex-Bundeskanzler Schröder und die hiergegen mobilisierten Widerstände der Gewerkschaften und in der eigenen Partei, aber auch die Auseinanderset-zungen in den Unionsparteien um die Zukunftsplanung des Sozialen. Protagonisten des „alten“ Sozialstaats wehren sich mit Verve gegen grundlegende Reformvorschläge und -beschlüsse der eigenen Parteien, einige sehen gar durch solche Erneuerungsansätze ihr Lebenswerk zerstört.
Entsprechend fallen die Verurteilungen der Umgestalter mit ihrer Einordnung in die feindliche Gruppe der sog. Neoliberalen recht unversöhnlich aus. Viele Kritiker der Vergangenheit meinen allerdings, dass die Geschichte des Sozialstaats in der Bundesrepublik Deutschland aus heutiger Sicht betrachtet nicht mehr einfach als Erfolgsgeschichte beschrieben werden kann, sondern auch und vor allem als Geschichte von Fehlentwicklungen und politischen Versäumnissen, die nunmehr die zentralen Bauelemente sozialstaatlicher Ordnung gefährden und Risiken wie Krise oder Niedergang heraufbeschwören. Weitgehende Reformunwilligkeit, aber auch große Fehlentscheidungen haben zur heutigen prekären Situation geführt: Als Stichworte seien nur genannt die Gestaltung der inneren Einheit in Deutschland, die horrende Staatsverschuldung, die Organisation der Pflegeversicherung im Umlageverfahren, die staatlich geschaf-fenen Möglichkeiten zur Frühverrentung mit riesigen Kosten für die sozialen Systeme, der Verzicht auf eine frühzeitig eingeführte staatlich geförderte kapitalgedeckte Eigenvorsorge fürs Alter, die hohen gesetzlichen Sozialabgaben und Belastungen des Faktors Arbeit, die großen Inflexibilitäten in Wirtschaft und Arbeitswelt und die Defizite in Bildung, Ausbildung, Wissenschaft und Forschung.
Reformen müssen sich heute auf Herausforderungen in fast allen Bereichen politischer Gestaltung beziehen, und sie dürfen nicht nur kleinere Reparaturen und Anpassungen beinhalten, sondern grundlegenden strukturellen Wandel, mit allen Konsequenzen für die Politikgestaltung, ihre Durchsetzung und Begründung gegenüber der Bevölkerung. REZENSION
Fundamentalkritik am demokratischen System könnte zu vorrevolutionären Zuständen führen
Von Ansgar Lange
Bonn/Grafschaft – Die Zweifel wachsen, ob der deutsche Sozialstaat auch in Zukunft funktionsfähig bleiben wird. Dies könnte erhebliche Auswirkungen auf unser politisches System haben, denn Demokratie und soziale Marktwirtschaft sind in der Bundesrepublik seit je „siamesische Zwillinge“. Zuletzt beförderte der hysterische Demographie-Thriller „2030 – Aufstand der Alten“ die Befürchtung, bestimmte negative Entwicklungen seien unausweichlich und von den Politikern nicht steuerbar. „Diese Meinung, die von Demokraten betriebene Politik sei generell in hohem Grade unfähig, kann unter der Voraussetzung sich weiter entwickelnder Enttäuschungen und Ängste zu grundlegender Demokratiefeindlichkeit führen“, schreibt Detlef Grieswelle in seinem Buch „Sozialstaat am Scheideweg“.
Die „Lust am Untergang“ sei in Deutschland weit verbreitet. Die linken Revoluzzer in den 60er Jahren erweckten den Eindruck, in diesem Staate ginge alles den Bach hinunter. Kassandra wurde anschließend zum Symbol für linken Alarmismus und Moralismus. Selbstverständlich war die Bundesrepublik vor 20, 30 oder 40 Jahren weit davon entfernt, ein Paradies zu sein. Doch an die Stelle eines rationalen Diskurses traten häufig Emotionalisierung und Moralisierung in Form der Krisen- und Katastrophenbeschwörung. Ironisch erklärten die beiden Publizisten Dirk Maxeiner und Michael Miersch 2006 zum „Jahr der ausgebliebenen Katastrophen“. Denn die Lust am Beschwören des Weltuntergangs in Form von Umweltzerstörung, Kriegen, Vogelgrippen und anderen Katastrophen hat bis heute nicht abgenommen. Die allermeisten Katastrophen sind zum Glück aber auch nicht eingetroffen.
Auch heute noch bestimmten Krisen-, Niedergangs- und Katastrophenmetaphern in nicht geringem Maße die intellektuellen Debatten unter Schriftstellern, Wissenschaftlern und Journalisten. Dabei stünden nicht mehr die so genannten Großrisiken, die die Fortexistenz der ganzen Welt in Frage stellten, im Zentrum, „sondern der Blick richtet sich auf zahlreiche Trends des Niedergangs in der Bundesrepublik Deutschland und hier auf defizitäre Entwicklungen vor allem in den sozio-ökonomischen Sektoren wie Wirtschaft, Arbeitswelt, soziale Sicherung, Bildung, Wissenschaft und Technik“. Der Glaube an politische Alternativen durch Wahl und Machtwechsel sei gering, bestenfalls erhoffe man sich ein besseres Handling. Pessimismus legt sich wie Mehltau auf das Land: Viele Rentner, Arbeitnehmer, mittelständische Selbständige und jungen Menschen werden von Zukunftsängsten erfasst.
Grieswelle warnt: „Für die Bürger der Bundesrepublik bedeutet dies, dass jener Staat, den sie als Sozialstaat bejaht haben, nunmehr Gefahr läuft, als Gefahrenquelle abgelehnt zu werden.(.)Ein heutiger Nostradamus würde höchstwahrscheinlich für die Beschreibung der Zukunft der Bundesrepublik Deutschland in Metaphern der Dekadenz Prophezeiungen machen, aber die wesentlichen Aporien und Gravamina können durch pragmatische politische Vernunft bewältigt werden, es bedarf nicht eines apokalyptischen Niedergangs, damit der Phönix sich aus der Asche erheben kann.“
Wie könnte unser Gemeinwesen aber wieder zu neuer Reformlust finden? Dazu brauchen wir – so der Autor – einen Konsens der Gesellschaft in vielen Grundfragen. Grieswelle nennt Beispiele: die Wiederentdeckung und Hochschätzung der Familie als grundlegender Lebensform der Gesellschaft, Eindämmung der Tendenzen zur Ego-Gesellschaft, stärkere Gewichtung von Leistung, Eigeninitiative und Selbständigkeit gegenüber Versorgung, sozialer Verteilung und Betreuung, zunehmende Skepsis gegenüber der Allmacht und Allzuständigkeit des Staates, stärkeres Bewusstsein für soziale Identitäten wie Heimat, Region, Nation als gemeinschaftsstiftende Kräfte, wachsende Bedeutung von Religion und Kirche im öffentlichen Diskurs etc.
Die Alternative: Wenn das Unbehagen an unserer Gesellschaftsform und Kultur anwachse, könne daraus durchaus eine Fundamentalkritik erwachsen mit daraus resultierenden „großen Legitimationsproblemen des Bestehenden und vorrevolutionären Situationen“. Für den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft könnte ganz entscheidend sein, so schließt Grieswelle sein lesenswertes Buch, inwieweit die beschriebenen Konsensressourcen zur Verfügung stehen.
Detlef Grieswelle: Sozialstaat am Scheideweg. Notwendigkeit struktureller Reformen. Vektor-Verlag: Grafschaft 2006, 298 Seiten, 28 Euro.
I. Enttabuisierung und Rationalität in öffentlichen Diskursen. Voraussetzungen für sozialpolitische Strukturreformen
1. Tabus in der öffentlichen Meinung 2. Forderung der politischen Korrektheit 3. Druck der veröffentlichten Meinung und rationaler Diskurs 4. Nation und Leitkultur 5. Leistungsschwächen in der Bundesrepublik Deutschland 6. Sozialer Wandel und demographischer Diskurs 7. Bevölkerung und Bevölkerungspolitik 8. Lebensformen 9. Innere Einheit und Ostdeutschland 10. Politische Korrektheit für Minderheiten und Randständige 11. Erörterung der Frage der Zuwanderung 12. Globalisierungsdiskurs 13. Ergebnis
II. Neue Kultur des Sozialstaats. Prinzipien und Leitbilder gegen Reformstau
1. Eigenverantwortung in solidarischer Ordnung 2. Bürgergesellschaft als umfassendes Leitbild politischer Gestaltung 3. Gerechtigkeit zwischen den Generationen 4. Entstaatlichung, Deregulierung und Flexibilisierung 5. Entfaltung der Humanressourcen 6. Gestaltungsprinzip der Prävention 7. Integration von Randgruppen und Hilfen für sozial Schwache
III. Gegenwärtige Reformpolitik und notwendige Entscheidungen. Grundlegender Wandel sozialpolitischer Gestaltung
1. Erneuerung der gesetzlichen Krankenversicherung 2. Umgestaltung der gesetzlichen Rentenversicherung 3. Neuordnung der gesetzlichen Pflegeversicherung 4. Reform der gesetzlichen Arbeitslosenversicherung und der Arbeitslosen- und Sozial-hilfe
IV. Durchsetzung von Reformen durch Eliten. Verbesserung der Strategien und institutionellen Rahmenbedingungen
1. Leistung der Eliten 2. Abbau von Besitzständen 3. Perspektiven und Argumente für Reformen
V. Gefährdung der Demokratie? Demokratische Tradition und Zusammenhalt des Gemeinwesens
Anmerkungen
Heute wird man nicht umhin kommen, festzustellen, dass das gesamte politische System in Deutschland bezüglich grundlegender struktureller Reformen in der Vergangenheit weitgehend versagt hat, vor allem bei der Erneuerung des Sozialstaats, aber auch in vielen anderen Fel-dern wie Wirtschaft, Bildung, Forschung usf. Es ist heute zu einem großen Problemstau gekommen, der vor dem Hintergrund gewachsener Einstellungen, Verhaltensweisen und institutioneller Regelungen von den politischen Akteuren nur mit großen Schwierigkeiten abzubauen ist, vor allem, was die Begründung, Durchsetzung und Akzeptanz sozialpolitischer Innovationen angeht. Es fällt insbesondere schwer, die Reformen als unabdingbare Veränderungen plausibel zu machen und bei der Bevölkerung den Eindruck zu erwecken, dass die Umgestaltung des Sozialstaats auch als Chance zu begreifen ist. Welche kollosalen Meinungskämpfe die Strukturreformer gegen jene, die eine kurzatmige, kurzfristige und nur partielle Reformen ins Auge fassende Politik betrieben haben, heute bestreiten müssen, zeigen die doch recht zurückhaltenden Reformen bzw. Reformansätze von Ex-Bundeskanzler Schröder und die hiergegen mobilisierten Widerstände der Gewerkschaften und in der eigenen Partei, aber auch die Auseinanderset-zungen in den Unionsparteien um die Zukunftsplanung des Sozialen. Protagonisten des „alten“ Sozialstaats wehren sich mit Verve gegen grundlegende Reformvorschläge und -beschlüsse der eigenen Parteien, einige sehen gar durch solche Erneuerungsansätze ihr Lebenswerk zerstört.
Entsprechend fallen die Verurteilungen der Umgestalter mit ihrer Einordnung in die feindliche Gruppe der sog. Neoliberalen recht unversöhnlich aus. Viele Kritiker der Vergangenheit meinen allerdings, dass die Geschichte des Sozialstaats in der Bundesrepublik Deutschland aus heutiger Sicht betrachtet nicht mehr einfach als Erfolgsgeschichte beschrieben werden kann, sondern auch und vor allem als Geschichte von Fehlentwicklungen und politischen Versäumnissen, die nunmehr die zentralen Bauelemente sozialstaatlicher Ordnung gefährden und Risiken wie Krise oder Niedergang heraufbeschwören. Weitgehende Reformunwilligkeit, aber auch große Fehlentscheidungen haben zur heutigen prekären Situation geführt: Als Stichworte seien nur genannt die Gestaltung der inneren Einheit in Deutschland, die horrende Staatsverschuldung, die Organisation der Pflegeversicherung im Umlageverfahren, die staatlich geschaf-fenen Möglichkeiten zur Frühverrentung mit riesigen Kosten für die sozialen Systeme, der Verzicht auf eine frühzeitig eingeführte staatlich geförderte kapitalgedeckte Eigenvorsorge fürs Alter, die hohen gesetzlichen Sozialabgaben und Belastungen des Faktors Arbeit, die großen Inflexibilitäten in Wirtschaft und Arbeitswelt und die Defizite in Bildung, Ausbildung, Wissenschaft und Forschung.
Reformen müssen sich heute auf Herausforderungen in fast allen Bereichen politischer Gestaltung beziehen, und sie dürfen nicht nur kleinere Reparaturen und Anpassungen beinhalten, sondern grundlegenden strukturellen Wandel, mit allen Konsequenzen für die Politikgestaltung, ihre Durchsetzung und Begründung gegenüber der Bevölkerung. REZENSION
Fundamentalkritik am demokratischen System könnte zu vorrevolutionären Zuständen führen
Von Ansgar Lange
Bonn/Grafschaft – Die Zweifel wachsen, ob der deutsche Sozialstaat auch in Zukunft funktionsfähig bleiben wird. Dies könnte erhebliche Auswirkungen auf unser politisches System haben, denn Demokratie und soziale Marktwirtschaft sind in der Bundesrepublik seit je „siamesische Zwillinge“. Zuletzt beförderte der hysterische Demographie-Thriller „2030 – Aufstand der Alten“ die Befürchtung, bestimmte negative Entwicklungen seien unausweichlich und von den Politikern nicht steuerbar. „Diese Meinung, die von Demokraten betriebene Politik sei generell in hohem Grade unfähig, kann unter der Voraussetzung sich weiter entwickelnder Enttäuschungen und Ängste zu grundlegender Demokratiefeindlichkeit führen“, schreibt Detlef Grieswelle in seinem Buch „Sozialstaat am Scheideweg“.
Die „Lust am Untergang“ sei in Deutschland weit verbreitet. Die linken Revoluzzer in den 60er Jahren erweckten den Eindruck, in diesem Staate ginge alles den Bach hinunter. Kassandra wurde anschließend zum Symbol für linken Alarmismus und Moralismus. Selbstverständlich war die Bundesrepublik vor 20, 30 oder 40 Jahren weit davon entfernt, ein Paradies zu sein. Doch an die Stelle eines rationalen Diskurses traten häufig Emotionalisierung und Moralisierung in Form der Krisen- und Katastrophenbeschwörung. Ironisch erklärten die beiden Publizisten Dirk Maxeiner und Michael Miersch 2006 zum „Jahr der ausgebliebenen Katastrophen“. Denn die Lust am Beschwören des Weltuntergangs in Form von Umweltzerstörung, Kriegen, Vogelgrippen und anderen Katastrophen hat bis heute nicht abgenommen. Die allermeisten Katastrophen sind zum Glück aber auch nicht eingetroffen.
Auch heute noch bestimmten Krisen-, Niedergangs- und Katastrophenmetaphern in nicht geringem Maße die intellektuellen Debatten unter Schriftstellern, Wissenschaftlern und Journalisten. Dabei stünden nicht mehr die so genannten Großrisiken, die die Fortexistenz der ganzen Welt in Frage stellten, im Zentrum, „sondern der Blick richtet sich auf zahlreiche Trends des Niedergangs in der Bundesrepublik Deutschland und hier auf defizitäre Entwicklungen vor allem in den sozio-ökonomischen Sektoren wie Wirtschaft, Arbeitswelt, soziale Sicherung, Bildung, Wissenschaft und Technik“. Der Glaube an politische Alternativen durch Wahl und Machtwechsel sei gering, bestenfalls erhoffe man sich ein besseres Handling. Pessimismus legt sich wie Mehltau auf das Land: Viele Rentner, Arbeitnehmer, mittelständische Selbständige und jungen Menschen werden von Zukunftsängsten erfasst.
Grieswelle warnt: „Für die Bürger der Bundesrepublik bedeutet dies, dass jener Staat, den sie als Sozialstaat bejaht haben, nunmehr Gefahr läuft, als Gefahrenquelle abgelehnt zu werden.(.)Ein heutiger Nostradamus würde höchstwahrscheinlich für die Beschreibung der Zukunft der Bundesrepublik Deutschland in Metaphern der Dekadenz Prophezeiungen machen, aber die wesentlichen Aporien und Gravamina können durch pragmatische politische Vernunft bewältigt werden, es bedarf nicht eines apokalyptischen Niedergangs, damit der Phönix sich aus der Asche erheben kann.“
Wie könnte unser Gemeinwesen aber wieder zu neuer Reformlust finden? Dazu brauchen wir – so der Autor – einen Konsens der Gesellschaft in vielen Grundfragen. Grieswelle nennt Beispiele: die Wiederentdeckung und Hochschätzung der Familie als grundlegender Lebensform der Gesellschaft, Eindämmung der Tendenzen zur Ego-Gesellschaft, stärkere Gewichtung von Leistung, Eigeninitiative und Selbständigkeit gegenüber Versorgung, sozialer Verteilung und Betreuung, zunehmende Skepsis gegenüber der Allmacht und Allzuständigkeit des Staates, stärkeres Bewusstsein für soziale Identitäten wie Heimat, Region, Nation als gemeinschaftsstiftende Kräfte, wachsende Bedeutung von Religion und Kirche im öffentlichen Diskurs etc.
Die Alternative: Wenn das Unbehagen an unserer Gesellschaftsform und Kultur anwachse, könne daraus durchaus eine Fundamentalkritik erwachsen mit daraus resultierenden „großen Legitimationsproblemen des Bestehenden und vorrevolutionären Situationen“. Für den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft könnte ganz entscheidend sein, so schließt Grieswelle sein lesenswertes Buch, inwieweit die beschriebenen Konsensressourcen zur Verfügung stehen.
Detlef Grieswelle: Sozialstaat am Scheideweg. Notwendigkeit struktureller Reformen. Vektor-Verlag: Grafschaft 2006, 298 Seiten, 28 Euro.