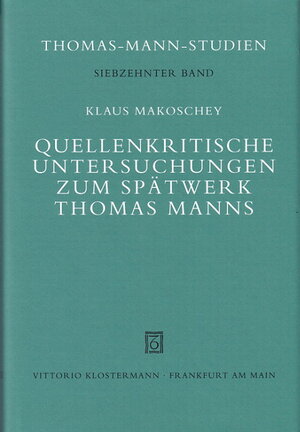
×
![Buchcover ISBN 9783465029373]()
Quellenkritische Untersuchungen zum Spätwerk Thomas Manns
"Joseph, der Ernährer", "Das Gesetz", "Der Erwählte"
von Klaus MakoscheyIm Bannkreis des großen Josephsromans stehen auf recht unterschiedliche Weise zwei vermeintliche Nebenwerke Thomas Manns: als alttestamentarisches Satyrspiel folgt die Moses- Novelle „Das Gesetz“ unmittelbar auf die Josephs- Tetralogie. Deren künstlerische Prinzipien, das märchenhafte Handlungsmuster und das großangelegte Spiel mit der Sprache, greift Thomas Mann nach dem Doktor Faustus erneut auf und transponiert sie in das legendenhafte Mittelalter des „Erwählten“.
Beide Werke werden unter Verwendung von Thomas Manns Nachlaß auf breiter quellenkritischer Basis analysiert. Thomas Manns Arbeitsnotizen zum „Gesetz“ werden hier erstmals der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Auf der Grundlage dieser Edition ist die Novelle nunmehr genauer interpretierbar als gewagte Verschmelzung von Künstlerproblematik und politischer Parabel: Thomas Manns Mose ist zugleich ein diktatorischer Visionär und ein Bildhauer mit Zügen Michelangelos. Die Formung der marmornen Gesetzestafeln zum einzigartigen Kunstwerk dient als Metapher des durchaus ambivalent gesehenen Zivilisationsprozesses seines auserwählten Volkes. Dagegen ist Papst Gregor, der „Erwählte“, wieder ein märchenhaft guter Diktator wie Joseph. Thomas Mann erzählt Hartmanns von Aue Epos vom „guten Sünder“ Gregorius auf dem Hintergrund eines sprachlich evozierten christlichen Mittelalters humoristisch als Ödipus-Geschichte, indem er das inzestuöse Paar Gregor/Sibylla zwischen Ödipus/Jokaste und Christus/Madonna changieren läßt. Wie weitreichend der Ödipus-Horizont des Romans einerseits bis in sprachlich feinste Nuancen die Kulturpsychologie Sigmund Freuds einschließt, andererseits aber auch der Tragödie des Sophokles verpflichtet ist, deckt erstmals diese Untersuchung auf.
Beide Werke werden unter Verwendung von Thomas Manns Nachlaß auf breiter quellenkritischer Basis analysiert. Thomas Manns Arbeitsnotizen zum „Gesetz“ werden hier erstmals der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Auf der Grundlage dieser Edition ist die Novelle nunmehr genauer interpretierbar als gewagte Verschmelzung von Künstlerproblematik und politischer Parabel: Thomas Manns Mose ist zugleich ein diktatorischer Visionär und ein Bildhauer mit Zügen Michelangelos. Die Formung der marmornen Gesetzestafeln zum einzigartigen Kunstwerk dient als Metapher des durchaus ambivalent gesehenen Zivilisationsprozesses seines auserwählten Volkes. Dagegen ist Papst Gregor, der „Erwählte“, wieder ein märchenhaft guter Diktator wie Joseph. Thomas Mann erzählt Hartmanns von Aue Epos vom „guten Sünder“ Gregorius auf dem Hintergrund eines sprachlich evozierten christlichen Mittelalters humoristisch als Ödipus-Geschichte, indem er das inzestuöse Paar Gregor/Sibylla zwischen Ödipus/Jokaste und Christus/Madonna changieren läßt. Wie weitreichend der Ödipus-Horizont des Romans einerseits bis in sprachlich feinste Nuancen die Kulturpsychologie Sigmund Freuds einschließt, andererseits aber auch der Tragödie des Sophokles verpflichtet ist, deckt erstmals diese Untersuchung auf.


