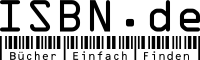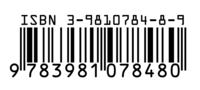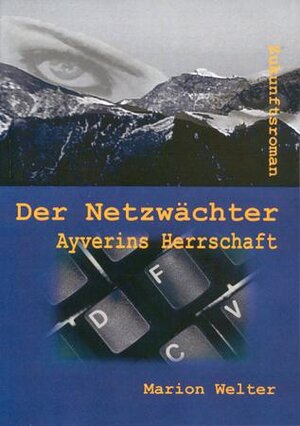
×
![Buchcover ISBN 9783981078480]()
Für alle die Technik, Mystik und Spiritualität verbinden können und die auch eine gute Geschichte bevorzugen.
Auszug
Sie stand bereits neben ihm, ihre Schulter berührte seinen Arm. Der zarte Duft ihres Haares stieg ihm in die Nase. Ihm wurde heiß und kalt. Ihre Nähe raubte ihm schier den Verstand. Die Welt war plötzlich still, es gab nur sie und ihn. Er versank in ihrem Blick. Sie griff nach seiner Hand. „Komm mit“, flüsterte sie. „Ich will dir etwas zeigen.“ Alle machten ihnen Platz. Im Weggehen fing Admos Haglins Augenzwinkern auf. ‚Nur Mut’, schien er zu sagen. Sein Herz rutschte zwei Stockwerke tiefer. Wortlos ließ er sich von Ayverin führen. Sie gingen durch viele Gassen. In allen war er schon gewesen, bis sie an einer Kreuzung einen Weg einschlug, den er nicht kannte. Es ging sehr steil hinab, und nur noch wenige Fackeln brannten an den Wänden. „Wohin gehen wir?“ Er konnte seine Neugier nicht unterdrücken. „Warte es ab“, lächelte sie. Der Gang machte unerwartet einen scharfen Knick. „Wir sind gleich da“, raunte sie ihm zu. Dann war der Gang zu Ende, und sie blieb stehen. Er trat neben sie, und ihm stockte der Atem.Sie standen in einer Grotte, nur wenige Meter über einem See. Die Wasseroberfläche war glatt und spiegelblank. An einer Seite führte eine kleine, in Stein gehauene Treppe hinunter, an der anderen Seite reichten Stufen nach oben, so hoch, daß man ihr Ende von unten nicht erkennen konnte. Weit oben mußte es einen Felsspalt geben, denn diffuses Licht fiel auf den See und ließ das Wasser glitzern. „Es ist wundervoll“, flüsterte er. „Ja“, wisperte sie zurück und begann vorsichtig, die Stufen hinabzusteigen. Er folgte ihr. Als sie unten angekommen waren, setzte sie sich auf einen Stein und tauchte eine Hand ins Wasser. Er sah die kleinen Wellen, die ihre Bewegung erzeugte. Er suchte sich einen Stein und setzte sich ebenfalls. „Warum sind wir hier?“ Seine Stimme hallte wieder, obwohl er leise gesprochen hatte. Ayverin sah nach oben. „Du solltest Dondren kennenlernen, bevor er euch begleitet.“ „Wo ist er?“ Admos schaute sich um. „Meine Wölfe kommen hierher, wenn ich bei Großmutter bin. Sie mögen es nicht, im Berg eingesperrt zu sein. Von hier können sie nach draußen.“ Sie zeigte in die Höhe. „Dort oben ist die Öffnung des Gimah Toe, daher kommt das Licht, das du siehst.“ Admos pfiff durch die Zähne. „Dann liegt auf dem Grund dieses Sees mein Netznavigator.“ Sie sah ihn verwirrt an. „Was ist das?“ Er lächelte. „Das ist ein Gerät, mit dem man Nachrichten austauschen und Programme schreiben kann, die andere Maschinen ausführen.“ „Du sprichst damit. Davon habe ich schon gehört. Das Volk glaubt, daß du ihnen sagen kannst, daß sie aufhören sollen, uns zu verfolgen.“ „Glaubst du es nicht?“ Sie seufzte. „Ich verstehe nichts von solchen Dingen. Ich war nie in deiner Welt, um zu lernen oder zu studieren. Ich kenne nur Tiere und die Natur.“ Sie sah ein wenig traurig aus. „Ich glaube nicht, daß dir diese Welt gefallen würde“, erwiderte er. „Dort gibt es keine Natur. Es ist laut, schmutzig und stinkt. Tiere werden in Käfige gesperrt, damit man sie anschauen kann. Die Berge sind Häuser aus Glas und Beton, statt Pferden gibt es Kästen aus Metall. Man setzt sich hinein, sie fahren auf Rädern, machen Lärm und verpesten die Luft.“ Sie hörte ihm verwundert zu. „Warum wollen die Menschen dort so leben?“ Er zuckte die Schultern. „Das ist schon seit Ewigkeiten so. Sie wissen nicht mehr, wie es anders geht. Sie sind zu bequem. Deshalb arbeiten auch hauptsächlich Maschinen, nicht die Menschen.“ „Und was tun die Menschen, wenn sie nicht arbeiten?“ „Nichts“, antwortete er, „man braucht Geld für alles. Viele haben durch die Maschinen ihre Arbeit verloren und bekommen deshalb kein Geld. Sie sind arm. Sie sind krank, weil sie keinem Arzt Geld geben können, damit er sie heilt. Ihre Kinder haben Hunger, weil kein Geld für Essen da ist. Sie erfrieren im Winter, denn es ist sehr kalt und sie haben kein Geld für die Heizung. Oft haben sie nicht einmal ein Zuhause. Sie leben draußen, auf der Straße.“ Er sah ihren entsetzten Blick. „Mußt du auch so leben?“ Er hatte diese Frage befürchtet. „Nein“, sagte er leise. „Ich bin einer von denen, die den Maschinen sagen, was sie tun sollen. Dafür bekomme ich viel Geld.“ „Gibst du den Armen etwas davon?“ Beschämt senkte er den Kopf. Sie würde seine Antwort niemals gutheißen, trotzdem kam es ihm nicht in den Sinn, sie zu belügen. „Ich habe es bisher nicht getan“, gestand er und suchte nach dem Loch im Erdboden, in das er sich fallen lassen könnte, um ihrem Verhör zu entfliehen. „Warum nicht?“ Sie klang nur traurig, nicht empört. Ihre Enttäuschung über seinen Egoismus ließ ihn verzweifeln. Niemals würde dieses wunderbare Geschöpf ihn erhören. ‚Sie beschützt alle Schwachen’, hatte Haglin gesagt. Er dagegen hatte dazu beigetragen, daß sie zerbrachen. Sie würde sich nie mit jemandem einlassen, der gegen ihren Auftrag handelte. „Ich habe es nicht anders gekannt.“ Er war am Boden zerstört, aber er würde es ertragen bis zum Schluß. Er hob den Kopf und sah sie an. „In dieser Welt ist das nicht wie hier. Dort kämpft jeder für sich allein. Es gibt viele kleine Gemeinschaften, nicht eine große wie bei uns. In der Gesellschaft, in der ich gelebt habe, ist es verboten, die Armen zu beachten oder ihnen zu helfen. Dann wird man selbst ausgestoßen und verliert alles. Es sind ungeschriebene Gesetze, so wie hier. Alle befolgen sie, denn keiner will sich selbst erledigen.“ Sie lauschte aufmerksam. „Und du wirst ihre Gesetze weiter befolgen, wenn du zurückgehst, weil du es mußt. Niemand darf Verdacht schöpfen, nicht wahr?“ Sein Blick wurde hart. „Das kann ich nicht“, sagte er entschlossen. „Ich bin kein Mensch dieser Welt mehr. Ich bin ein Silanglió und richte mich nach unseren Gesetzen. Ich werde Menschen keine Hilfe mehr versagen. Ich habe dort einen gewissen Einfluß. Sie werden sich das Maul zerreißen, aber sie brauchen mich. Mir kann niemand etwas verbieten.“ Sie beobachtete ihn genau. „Du würdest deinen Auftrag gefährden, den du von uns hast, um den Schwachen in dieser Welt beizustehen?“ Verflixt, sie zog die einzig logischen Schlüsse. Er ahnte, daß es keinen Zweck hatte, um den heißen Brei herumzureden. Vermutlich hatte er sowieso schon zu viel gesagt. Hier half ihm nur Aufrichtigkeit. Er blieb ruhig. „So habe ich das nicht gemeint“, sagte er und ärgerte sich darüber, wie einfältig das klang. Er holte tief Luft. „Ich bin sicher, daß ich beides miteinander verbinden kann. Man kann vieles im Verborgenen tun. Wenn ich es einigermaßen geschickt anstelle, wird niemand auf dumme Gedanken kommen.“ „Entschuldige“, sagte sie reumütig, „daß ich dir solche Fragen stelle. Es geht mich nichts an, wie du uns rettest. Du mußt tun, was nötig ist.“ „Nein“, wehrte er ab. „Du hast recht mit dem, was du denkst. Ich war selbstsüchtig und überheblich. Ich habe das Elend gesehen und mich nicht darum gekümmert. Es war mir gleichgültig. Hier habe ich gelernt, was es heißt, Verantwortung zu tragen. Mich selbst nicht so wichtig zu nehmen. Ich kann die Welt nicht mehr ändern. Aber vielleicht habe ich die Gelegenheit, etwas wiedergutzumachen.“ Sie streckte langsam ihre Hand nach ihm aus und berührte sein Gesicht. „Verzeih mir“, flüsterte sie. „Ich wollte nur sicher sein, wie der Mann denkt, der für mich bestimmt ist.“ Er hielt ihre Hand fest und schloß für einen Moment die Augen. Sie wußte es, wie er. „Du bist so streng zu dir“, sagte sie sanft. „Dein Gewissen quält dich. Du glaubst, daß du verloren bist. Aber das stimmt nicht, weil ich bei dir bin und es immer sein werde.“ Er ließ die Hand sinken und sah sie an. Ihre Augen waren weit offen und tief, so tief, er sah das unglaubliche Grün und entdeckte darin ein paar bernsteinfarbene Punkte. Er fühlte sich grenzenlos zu ihr hingezogen. „Ich muß doch fort“, preßte er hervor. „Ich weiß. Kommst du nicht zurück?“ Ihre Besorgnis war unüberhörbar. Er stand auf und zog sie hoch. Still standen sie voreinander und sahen sich in die Augen. Seine Brust schmerzte, als würde sie auseinandergerissen. Nie hatte er so empfunden. War das Liebe? „Wartest du auf mich?“ „Ja“, ihre Stimme war nicht mehr als ein Hauch. Er umfing ihre Schultern und zog sie dichter zu sich heran. Sie hob ihr Gesicht, um ihn anzusehen. Er wurde unsicher. Wie weit durfte er gehen? Er bereute, daß er Haglin nicht danach gefragt hatte. Sie fühlte seinen Zwiespalt. ‚Tu doch einfach, was du willst’, er hörte ihre Worte in seinem Kopf. Die leise, helle Stimme, die er so gut kannte. Sie hatte es erlaubt. Sein Blick brannte in ihrem, als er ihre Lippen berührte. Er wollte sie spüren und wagte es nicht. Er legte vorsichtig seine Arme um sie, als hätte er Angst, sie könnte schreiend davonlaufen. Aber sie tat nichts dergleichen. Sie seufzte, schloß die Augen und fuhr zärtlich mit den Händen über seinen Rücken. Ein süßes, schweres Gefühl breitete sich in ihm aus und zog ihn mit sich. Wasser, es kam aus ihrer Seele und lief in ihn hinein, nahm jeden Winkel seines Ichs für sich. Es rann und floß in jede seiner Ecken, spülte alle Erinnerungen fort und trug ihn davon. Sein Geist explodierte. Ihr Kuß öffnete ihn wie eine Fontäne, hob ihn empor und stürzte ihn wieder tosend in die Tiefe wie ein gigantischer Wasserfall. Er fühlte den Sturm nahen und ließ sich mit ihr auf den Steinboden fallen. Er wollte sie besitzen, hier und jetzt, und es kümmerte ihn nicht, wo er war. Sie ergab sich seiner Macht, als er behutsam in sie drang. Sie eroberten Meridiane, die er nie zuvor erreicht hatte. Er nahm sie mit auf seine Reise, höher und höher, Wasser und Luft, sie verbanden sich zu einem untrennbaren Gemisch, das durch ihre Seelen strömte. Als er in ihr zerging, entfesselte er den Sturm, der gewartet hatte, bis er ihn rief. Er beschwor eine Windhose unvorstellbaren Ausmaßes und jagte sie über ihre See. Ihr Wasser stieg mit ihm auf und drehte sich in beispielloser Geschwindigkeit. Grelle Blitze zuckten in ihm, bis er nichts mehr für sie hatte. Erschöpft fiel er über ihr zusammen und fühlte zu seinem Entsetzen ihre Tränen. „Was habe ich getan?“ „Nein“, sie hielt ihn. „Ich weine, weil ich glücklich bin. Ich war noch nie so glücklich.“ Er küßte sie zart. Ihre Liebe nahm ihn gefangen, er fühlte sie in seinem Geist, sie war überall. Er konnte sie nicht verlassen, nie mehr ohne sie sein, sie war ein Teil von ihm und er von ihr. So war es immer gewesen, seit Anbeginn der Zeit, das Schicksal hatte sie zusammengeführt und niemand konnte ernsthaft glauben, daß er sein Leben wieder aufgab. Er rollte sich auf die Seite und betrachtete sie, ihr Haar duftete und ihre Augen schimmerten wie Smaragde in der Sonne. Ihre Hände streichelten sein Gesicht. „Du kannst nicht hier bleiben, noch nicht“, wisperte sie. Sie las seine Gedanken. Widerwille regte sich in ihm. Er wollte die Magie ihres ersten Zusammenseins nicht verderben. Aber er würde nicht gehen. „Wenn du es nicht tust, haben auch wir beide keine Zukunft. Du mußt es tun, für uns alle.“ Er setzte sich auf und preßte die Lippen zusammen. „Bitte, Admos.“ Sie flüsterte, schmiegte sich an ihn, und er wußte, daß sie weinte. Er nahm sie in den Arm. „Wie kann ich jetzt gehen, da ich dich gerade gefunden habe?“, fragte er leise. „Wie soll ich dich verlassen? Ich weiß nicht mal, ob ich eine Chance habe. Vielleicht komme ich nicht zurück. Vielleicht töten sie mich. Willst du um mich weinen? Dann tue es jetzt, wenn ich wirklich gehe.“ Tränen rollten über ihre Wangen. „Reicht dir das?“ Sie schluchzte auf. Es zerriß ihm das Herz. Er nahm ihr Gesicht in beide Hände und wischte mit den Daumen ihre Tränen fort. „Komm mit mir.“ „Ich war schon immer bei dir“, hauchte sie. „Du hast es nur nicht gewußt. Jetzt kannst du mich erst fühlen und sehen. Ich gehe mit dir, aber nicht so, wie du es dir vorstellst. Mein Körper bleibt hier. Die Schwachen brauchen mich. Das Volk braucht dich. Wir haben beide unsere Aufgabe. Wir müssen sie zu Ende führen.“ Er sah ihr tief in die Augen. Er spürte, wie sie in ihm lebte, ihre Gegenwart füllte ihn aus. Ihre Elemente hatten sich verbunden, ihr Wasser stieg in ihm auf und kräuselte sich zu kleinen Wellen. Er wußte, daß er keine Möglichkeit hatte, aus dieser Prüfung auszusteigen. „Ich werde gehen“, sagte er unglücklich. „Ich weiß ja, daß du recht hast. Ich habe nur Angst, daß ich dich verliere.“ „Ich bin dein“, sie küßte seine Stirn, sanft wie der Flügelschlag eines Schmetterlings. „Ich gehöre dir seit Ewigkeiten. Nichts kann uns trennen, kein Raum, keine Zeit. Hab Vertrauen.“ Er zog sie an sich, seine Hände vergruben sich in ihrem Haar. Sein Blick fiel auf ihr Zeichen, das neben ihr lag. Es sah aus wie sein eigenes, bis auf den silbrigen Schimmer, der um ihres leuchtete. Warlajn hatte es gewußt. Das mußte der Grund sein, warum sie sich seiner angenommen hatte. Er seufzte, als er daran dachte, daß sie stets für ihn da gewesen war. Er wurde ihr Sohn, wenn er Ayverin zu sich nahm. Warlajn hatte es verdient, auf ihn stolz zu sein. Er würde sie nicht enttäuschen. Ayverin unterbrach seine Gedanken. Sie zog ihn hoch und führte ihn zum See. Sie ließ seine Hand los und stieg ins Wasser. Admos folgte ihr ohne zu zögern. Wieder fühlte er den Sturm nahen, als er ihre Wärme spürte. Er ließ sich Zeit, kostete sie aus, denn er wußte, es war das letzte Mal. Als er schließlich den Sturm rief, war Ayverin willenlos in seinen Händen und er glaubte endlich daran, daß sie für immer ihm gehörte.
„Wir müssen zurück.“ Ihre leise Stimme weckte ihn. Er nickte, die Zeit war um. Seit Stunden waren sie zusammen, aber nun begann der Abschied. Sie sprachen nicht, sahen sich nur an. Ayverin klammerte sich an ihn, als wolle sie ihn nie mehr loslassen. Er streichelte ihr Gesicht, ihre Haare, sog den Duft tief ein, um ihn nie zu vergessen. Er küßte sie, wieder und wieder, fühlte sie in sich und dachte, daß diese Erinnerung das einzige war, was er von ihr mitnehmen konnte.