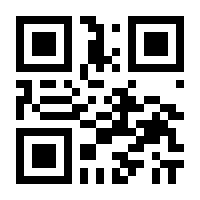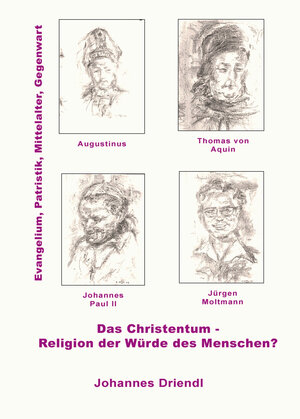
×
![Buchcover ISBN 9783946169499]()
Altes und Neues Testament.
Jeder Mensch wird unendlich
wichtig genommen.
Da ist jemand, der interessiert sich für
Menschen in unvollstellbarer Weise.
Dieses Bild, dass selbst die Haare des Menschen von Gott gezählt sind, findet sich im Evangelium und noch bei dem Philosophen Gottfried Leibniz. Es findet sich auch in dem schönen Lied von Eduard Mörike: „Weißt Du, wie viel Sternlein stehen?“. Alle Strophen schließen mit dem Refrain: „Gott, der Herr,
hat sie gezählet, dass ihm auch nicht eines fehlet“.
Gleiches gilt auch für die Frage, ob Gott sich für unsere moralische Einstellung, unsere Lebensführung und unseren Glauben so sehr interessiert, dass er für jeden Menschen in der einen Hand das Fallbeil der Verdammnis, in der anderen Hand das ewige Leben anbietet.
Wir können uns daher wichtig nehmen, weil uns jemand anderes unendlich wichtig nimmt und sogar akzeptiert, wie wir sind. Dies ist die heile Welt, die Welt des menschlichen Würde als Selbstwert.
Die Wirklichkeit, insbesondere das bleibende Elend
Jeder Mensch wird unendlich
wichtig genommen.
Da ist jemand, der interessiert sich für
Menschen in unvollstellbarer Weise.
Dieses Bild, dass selbst die Haare des Menschen von Gott gezählt sind, findet sich im Evangelium und noch bei dem Philosophen Gottfried Leibniz. Es findet sich auch in dem schönen Lied von Eduard Mörike: „Weißt Du, wie viel Sternlein stehen?“. Alle Strophen schließen mit dem Refrain: „Gott, der Herr,
hat sie gezählet, dass ihm auch nicht eines fehlet“.
Gleiches gilt auch für die Frage, ob Gott sich für unsere moralische Einstellung, unsere Lebensführung und unseren Glauben so sehr interessiert, dass er für jeden Menschen in der einen Hand das Fallbeil der Verdammnis, in der anderen Hand das ewige Leben anbietet.
Wir können uns daher wichtig nehmen, weil uns jemand anderes unendlich wichtig nimmt und sogar akzeptiert, wie wir sind. Dies ist die heile Welt, die Welt des menschlichen Würde als Selbstwert.
Die Wirklichkeit, insbesondere das bleibende Elend
Das Christentum - Religion der Würde des Menschen?
Evangelium, Patristik, Mittelalter, Gegenwart
von Johannes DriendlWer hat das Patent auf die Menschenwürde,
Philosophie oder Christentum ?
Bei dem lateinischen Denker und Redner Marcus Tullius Cicero taucht erstmals der Begriff menschlicher Würde auf, die jedoch abgestuft ist, verloren werden kann und dem männlichen Geschlecht vorbehalten ist. Schon der Sophist Protagoras im 4. Jhdt. v. Chr. hatte jedoch den Mensch als „Maß aller Dinge definiert. Athen wurde 338 durch Philipp geschleift, sodass es bezeichnend ist, dass der Kyniker Diogenes Alexander dem Großen, dessen Sohn, entgegengeschleudert hat, er sei Kosmopolit, Bürger der ganzen Welt. Durch diese Idee wurden die Sieger „humanitär diskreditiert“ (Arnold Gehlen). Früher Bürger der griechischen Polis (Stadtstaat), jetzt Provinzler, waren sie wieder wer. Selbstachtung und Neidvermeidungsstrategie gingen bei der Begründung menschlicher Würde Hand in Hand. Den begriffsgeschichtlichen Vorsprung der Antike holt das Christentum ideengeschichtlich ein, da es im Evangelium den Verachteten, Verlassenen und Verlorenen den gleichen Wert zugesteht wie den Etablierten und Arrivierten. Bei Jesus fällt auf, wie schroff er die sozial, kulturell und religiös Geachteten abkanzelt. Er ist vollständig auf Seiten der Abgehängten, er verkehrt mit den verachteten Zöllner und Huren und nimmt sogar die Ehebrecherin in Schutz. Das Christentum wird die Religion der Massen. Auch in Rom wird das Christentum als die Religion der kleinen Leute wahrgenommen (Kelsus versus Origines). Die menschliche Würde ist daher nicht abgestuft, sie kann nicht verloren gehen und sie ist an alle Menschen adressiert. In der Patristik werden die drei Grundaussagen des Alten und des Neuen Testaments zusammengefasst. Durch die Schöpfung wurde die Würde aller Menschen begründet, durch die Erlösung betätigt und durch die Verheißung eines ewigen Lebens erhöht. Der Abschied von der menschlichen Würde wird durch Augustinus eingeleitet, wonach der Mensch keinen eigenen Wert mehr hat. Im Mittelalter wird die „miseria hominis“, die Unwürdigkeit des Menschen zum zentralen Thema. Bis Mitte des 20. Jahrhunderts war die sündige Natur des Menschen die der evangelischen und katholischen Kirche gemeinsame Denkachse, bestätigt durch die damals führenden Theologen Friedrich Gogarten und Romano Guardini. Erst das Grundgesetz berief sich nicht nur auf Kant, sondern in der Aussage über die „Unantastbarkeit der Menschenwürde“ im Ergebnis auf das Christentum. Das Fragezeichen in der Überschrift „Christentum – Religion der Menschenwürde?“ bleibt daher erhalten.
Die religiöse, politische und rechtliche Dimension der Menschenwürde Der moderne Staat hat nach Thomas Hobbes allein die Aufgabe, die Würde des Menschen, sein Leben und seine Freiheit, zu schützen. Der Staat wird für ihn zum „sterblichen Gott“, dem wir unter dem „unsterblichen Gott“ den inneren und äußeren Frieden verdanken. Dennoch wird Thomas Hobbes wegen Atheismus verfolgt und muss aus England fliehen. Wer stark genug ist, alle zu schützen, ist auch stark genug, alle zu unterdrücken. Die Würde des Menschen, Leben und Freiheit, ist nach John Locke nicht nur gegen Verbrechen aus der Gesellschaft und gegen Bürgerkriege, sondern auch gegen Übergriffe des Staates, d. h. umfassend zu schützen. Die Idee der Menschenrechte entsteht. Auch Locke muss fliehen. Papst Pius VI. verurteilt die Ideen der Französischen Revolution, die die Menschenrechte auf den Weg bringen, als Sündentaumel. Die soziale Ermöglichung menschlicher Würde durch soziale Teilhabe hat erstmals Karl Marx als allgemeine politische Aufgabe formuliert, indem er das Feindbild der „Ausbeutung“ entwickelte. Der Mensch muss zum Schöpfer seiner selbst werden, was als Kampfansage an das Christentum verstanden wurde. Nur wenige Kirchenführer, wie z. B. der Sozialbischof Ketteler aus Mainz erkannten diese politische Dimension, die jetzt durch die „Theologie der Befreiung“ aufgegriffen wurde. Die Würde des Menschen wurde daher in drei Richtungen durch ihre Bedrohungen definiert. Die Kirchen haben die Zeichen der Zeit nicht erkannt. Die Würde des Menschen war kein Thema Selbst der christlich-pietistisch erzogene Kant war in seinen Frühschriften der Auffassung, dass der Mensch an sich völlig unwürdig sei. Nach dem 2. Weltkrieg lagen alle Ideologien in Trümmern. Die Väter des Grundgesetzes wandten sich gegen jede Staatsvergottung, wie es Konrad Adenauer formulierte. Mit dem Schutz und der Achtung menschlicher Würde wurden die Ideen von Hobbes und Locke rechtliche Wirklichkeit. Erst nach dem 2. Weltkrieg begann in den Kirchen ein Umdenkungsprozess. In der evangelischen und reformatorischen Theologie wird mit Recht die Frage diskutiert, warum die Thematik der Würde des Menschen in der Vergangenheit nicht beachtet wurde. Papst Johannes Paul II. wird zum Verfechter menschlicher Würde, ohne selbstkritisch zu sehen, dass seit der Patrologie über 1600 Jahre lang das Thema menschlicher Würde mit Ausnahme der Philosophie der Renaissance nicht beachtet wurde.
Bei dem lateinischen Denker und Redner Marcus Tullius Cicero taucht erstmals der Begriff menschlicher Würde auf, die jedoch abgestuft ist, verloren werden kann und dem männlichen Geschlecht vorbehalten ist. Schon der Sophist Protagoras im 4. Jhdt. v. Chr. hatte jedoch den Mensch als „Maß aller Dinge definiert. Athen wurde 338 durch Philipp geschleift, sodass es bezeichnend ist, dass der Kyniker Diogenes Alexander dem Großen, dessen Sohn, entgegengeschleudert hat, er sei Kosmopolit, Bürger der ganzen Welt. Durch diese Idee wurden die Sieger „humanitär diskreditiert“ (Arnold Gehlen). Früher Bürger der griechischen Polis (Stadtstaat), jetzt Provinzler, waren sie wieder wer. Selbstachtung und Neidvermeidungsstrategie gingen bei der Begründung menschlicher Würde Hand in Hand. Den begriffsgeschichtlichen Vorsprung der Antike holt das Christentum ideengeschichtlich ein, da es im Evangelium den Verachteten, Verlassenen und Verlorenen den gleichen Wert zugesteht wie den Etablierten und Arrivierten. Bei Jesus fällt auf, wie schroff er die sozial, kulturell und religiös Geachteten abkanzelt. Er ist vollständig auf Seiten der Abgehängten, er verkehrt mit den verachteten Zöllner und Huren und nimmt sogar die Ehebrecherin in Schutz. Das Christentum wird die Religion der Massen. Auch in Rom wird das Christentum als die Religion der kleinen Leute wahrgenommen (Kelsus versus Origines). Die menschliche Würde ist daher nicht abgestuft, sie kann nicht verloren gehen und sie ist an alle Menschen adressiert. In der Patristik werden die drei Grundaussagen des Alten und des Neuen Testaments zusammengefasst. Durch die Schöpfung wurde die Würde aller Menschen begründet, durch die Erlösung betätigt und durch die Verheißung eines ewigen Lebens erhöht. Der Abschied von der menschlichen Würde wird durch Augustinus eingeleitet, wonach der Mensch keinen eigenen Wert mehr hat. Im Mittelalter wird die „miseria hominis“, die Unwürdigkeit des Menschen zum zentralen Thema. Bis Mitte des 20. Jahrhunderts war die sündige Natur des Menschen die der evangelischen und katholischen Kirche gemeinsame Denkachse, bestätigt durch die damals führenden Theologen Friedrich Gogarten und Romano Guardini. Erst das Grundgesetz berief sich nicht nur auf Kant, sondern in der Aussage über die „Unantastbarkeit der Menschenwürde“ im Ergebnis auf das Christentum. Das Fragezeichen in der Überschrift „Christentum – Religion der Menschenwürde?“ bleibt daher erhalten.
Die religiöse, politische und rechtliche Dimension der Menschenwürde Der moderne Staat hat nach Thomas Hobbes allein die Aufgabe, die Würde des Menschen, sein Leben und seine Freiheit, zu schützen. Der Staat wird für ihn zum „sterblichen Gott“, dem wir unter dem „unsterblichen Gott“ den inneren und äußeren Frieden verdanken. Dennoch wird Thomas Hobbes wegen Atheismus verfolgt und muss aus England fliehen. Wer stark genug ist, alle zu schützen, ist auch stark genug, alle zu unterdrücken. Die Würde des Menschen, Leben und Freiheit, ist nach John Locke nicht nur gegen Verbrechen aus der Gesellschaft und gegen Bürgerkriege, sondern auch gegen Übergriffe des Staates, d. h. umfassend zu schützen. Die Idee der Menschenrechte entsteht. Auch Locke muss fliehen. Papst Pius VI. verurteilt die Ideen der Französischen Revolution, die die Menschenrechte auf den Weg bringen, als Sündentaumel. Die soziale Ermöglichung menschlicher Würde durch soziale Teilhabe hat erstmals Karl Marx als allgemeine politische Aufgabe formuliert, indem er das Feindbild der „Ausbeutung“ entwickelte. Der Mensch muss zum Schöpfer seiner selbst werden, was als Kampfansage an das Christentum verstanden wurde. Nur wenige Kirchenführer, wie z. B. der Sozialbischof Ketteler aus Mainz erkannten diese politische Dimension, die jetzt durch die „Theologie der Befreiung“ aufgegriffen wurde. Die Würde des Menschen wurde daher in drei Richtungen durch ihre Bedrohungen definiert. Die Kirchen haben die Zeichen der Zeit nicht erkannt. Die Würde des Menschen war kein Thema Selbst der christlich-pietistisch erzogene Kant war in seinen Frühschriften der Auffassung, dass der Mensch an sich völlig unwürdig sei. Nach dem 2. Weltkrieg lagen alle Ideologien in Trümmern. Die Väter des Grundgesetzes wandten sich gegen jede Staatsvergottung, wie es Konrad Adenauer formulierte. Mit dem Schutz und der Achtung menschlicher Würde wurden die Ideen von Hobbes und Locke rechtliche Wirklichkeit. Erst nach dem 2. Weltkrieg begann in den Kirchen ein Umdenkungsprozess. In der evangelischen und reformatorischen Theologie wird mit Recht die Frage diskutiert, warum die Thematik der Würde des Menschen in der Vergangenheit nicht beachtet wurde. Papst Johannes Paul II. wird zum Verfechter menschlicher Würde, ohne selbstkritisch zu sehen, dass seit der Patrologie über 1600 Jahre lang das Thema menschlicher Würde mit Ausnahme der Philosophie der Renaissance nicht beachtet wurde.