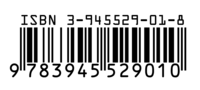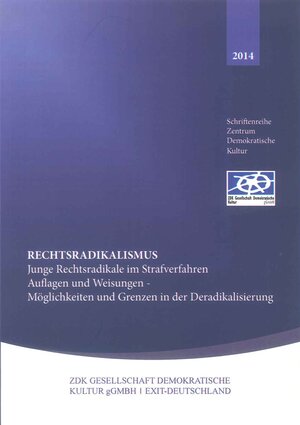
×
![Buchcover ISBN 9783945529010]()
Rechtsradikalismus - Junge Rechtsradikale im Strafverfahren Auflagen und Weisungen
Möglichkeiten und Grenzen in der Deradikalisierung
Vorwort
Der Rechtsradikalismus beschäftigt den Rechtsstaat und mithin den Sozialstaat in nicht unerheblicher Weise. Er ist für die demokratische Kultur eine Herausforderung und für die Menschenrechte, die Freiheit und Würde von Menschen eine strukturelle Gefahr. Die Frage ist, wie der Rechtsstaat dieser Herausforderung begegnet und sich tätig zu seiner freiheitlichen Essenz bekennt, indem er ein niedriges Kriminalitätsniveau und den Schutz der Freiheitsrechte von Individuen und Minderheitengruppen zu sichern weis. Das trifft in besonderem Maße auf rechtsradikale Angriffe, die auf die politisch-ethische Basis der demokratischen Kultur erfolgen, zu. Bundesweit sind Straftaten mit rechtsradikalem Ideologie- und Bindungshintergrund eine erhebliche sicherheitspolitische Größe, die auch makropolitisch von erheblicher Bedeutung ist und einen grundlegenden Indikator für die demokratische Kultur und ihres demokratischen Verfassungsstaates darstellt. Die öffentliche Präsenz von Rechtsradikalen bis in Parlamente hinein und die von ihnen ausgehende Kriminalität beeinflusst insgesamt und territorial unterschiedlich das Leben der demokratisch intendierten Gesellschaft und schränkt sie in ihrem Freiheitsgehalt oft massiv ein. Die Justiz insgesamt und resp. die Strafjustiz ist im Rahmen ihres grundgesetzlichen Auftrages bestrebt einen Beitrag zu leisten, das rechtsradikal intendierte und rechtswid- rige Handeln von rechtsradikalen Organisationen und Personen zurückzuweisen. Es ist sinnvoll, schon in frühen Stadien der rechten Radikalisierung durch staatliches Handeln einzuwirken, um die Radikalisierung abzubrechen, eine (politisch) kriminelle Karriere zu verhindern und Gruppen in ihre rechtlichen Schranken zu weisen.
Besonders sinnvoll ist dies in Bezug auf Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, da die Möglichkeiten von Einflussmaßen hier stärker gegeben sind. Das betrifft das gesellschaftliche und justizielle Potenzial und Instrumentarium ebenso wie die Erfahrungen in deradikalisierender Intervention. So kann beispielsweise über Sanktionen eine Wirkung erzielt werden. Gerade weniger Radikalisierte sollten im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten eher mit Instrumenten angesprochen werden, die nicht auf Freiheitsentzug abzielen, wenn denn die Wirkungsbedingungen beachtet werden und entsprechende deradikalisierend angelegte Brücken gebaut werden. Dazu können Auflagen und Weisungen dienen. Im Falle von Kriminalität, die in ihrem Gehalt eine Funktion des Rechtsradikalen (rechtsradikale Kriminalität) darstellt, ist das Strafrecht direkt in der Pflicht, sein soziales Potenzial auf die Intentionalität dieser Art von Kriminalität generalpräventiv wie rückfallverhütend auszurichten. Dabei geht es nicht nur um als Staatsschutzdelikte deklarierte Handlungen, sondern um jene Straftaten, deren intentionaler Impetus in eine rechtsradikale Richtung verweist. Diese Qualifizierung ist in der Praxis nicht immer leicht, liegt aber bei näherem und kenntnisreichem Hinsehen oft auf der Hand, woraus sich eine spezifische Vorgehensweise im Strafverfahren ergeben kann. Die Einstufung als Staatsschutzdelikt nach den kriminalstatistischen Kriterien der Polizeien gibt dafür besondere Hinweise. Angesichts der Tatsache, dass auch rechtsradikale Kriminalität unterschiedliche Merkmale sozialer Schädlichkeit aufweist, ergibt sich daraus, dass die Strafrechtsprechung unterschiedliche Sanktionen bereitzuhalten hat und verschiedene individualisiert angelegte erzieherische Instrumente einsetzt. Im Falle von jugendlichen und jungerwachsenen Rechtsradikalen und ihren freiheitsfeindlichen Straftaten gilt das in einem besonderen Maße, um unnötige Radikalisierungen durch hyperventilierende Repression zu vermeiden und zugleich Lernpfade demokratischer und menschenrecht- lich imperativer Valenz zu legen. In dieses Spektrum gehören Auflagen und Weisungen. Im Folgenden sollen zur Wirksamkeit dieser juristischen Instrumente Erfahrungen dargelegt werden, die in der Strafrechtsprechung gewonnen wurden und durch Aussteiger aus der rechtsradikalen Szene bewertet werden. Zu diesem Zweck wurden 201 Amtsträger bundesweit in unterschiedlichen Funktionen im Strafverfahren angesprochen und auflaufende Erfahrungen zur Wirkung der Instrumente und den Kriterien ihrer Anwendung aufgenommen. Zugleich wurden aus 503 Ausstiegsfälle sachliche Verwertbarkeiten herausgefiltert und verarbeitet sowie mit 10 Aussteigern intensive Auswertungen, darunter ein Gruppengespräch, durchgeführt. Ihre Erfahrungen wurden über den individuellen Fall der jeweiligen Strafverfahren hinaus ausgewertet, da sie durch ihre ehemals herausgehobenen Funktionen im rechtsradikalen Kontext weitergehende Überblicke besaßen. Bei der Arbeit handelt es sich um keine elaborierte Studie, sondern um ein Pilotprojekt, um einen Einstieg in ein systematisches, forschungsrelevantes und praktisches Vorgehen anzulegen und den dazu erforderlichen Diskurs zu intensivieren und inhaltlich anzureichern. Aus den vorliegenden Ergebnissen werden Erfahrungen zusammengefasst und einige Vorschläge unterbreitet, wie mit Auflagen und Weisungen im Hinblick auf eine deradikalisierende Wirkung rechtsradikaler Täter umgegangen werden kann und welche Probleme dabei bestehen, welche Bedingungen sowie Angebote dabei von Belang sein können. Es sollen Anregungen gegeben werden, die dazu beitragen können, die Qualität und Wirksamkeit von Sanktionen in der Praxis der staatlichen Institutionen und freien Träger zu erhöhen. Dabei ist es vorteilhaft die Prozesse von ihrem Ende her zu denken, das heißt in diesem Fall von dem Zustand der Deradikalisiertheit des ehemals straffälligen Rechtsradikalen ausgehend, der seine Taten als Funktion seiner Radikalität ausführte. Jene, die diesen Zustand mit einer basalen Reflektiertheit für sich erreicht haben – so zeigen die langjährigen Erfahrungen von EXIT-Deutschland – treten nicht mehr mit rechtsradikalen Delikten hervor.
Die Arbeit wurde im Jahr 2013 durch die Ministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger angeregt und durch das Bundesministerium der Justiz gefördert. Dafür möchte sich das Projektteam, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der ‚ZDK Gesellschaft Demokratische Kultur gGmbH / Initiative EXIT-Deutschland‘ und ehemalige Mitglieder militanter rechtsradikaler Organisationen des ‚Aktionskreises ehemaliger Extremisten‘ bei ‚EXIT-Deutschland‘ bedanken. Das Team hofft, dass die Arbeit neue Impulse in der Auseinandersetzung mit dem Rechtsradikalismus setzt.
Bernd Wagner
Der Rechtsradikalismus beschäftigt den Rechtsstaat und mithin den Sozialstaat in nicht unerheblicher Weise. Er ist für die demokratische Kultur eine Herausforderung und für die Menschenrechte, die Freiheit und Würde von Menschen eine strukturelle Gefahr. Die Frage ist, wie der Rechtsstaat dieser Herausforderung begegnet und sich tätig zu seiner freiheitlichen Essenz bekennt, indem er ein niedriges Kriminalitätsniveau und den Schutz der Freiheitsrechte von Individuen und Minderheitengruppen zu sichern weis. Das trifft in besonderem Maße auf rechtsradikale Angriffe, die auf die politisch-ethische Basis der demokratischen Kultur erfolgen, zu. Bundesweit sind Straftaten mit rechtsradikalem Ideologie- und Bindungshintergrund eine erhebliche sicherheitspolitische Größe, die auch makropolitisch von erheblicher Bedeutung ist und einen grundlegenden Indikator für die demokratische Kultur und ihres demokratischen Verfassungsstaates darstellt. Die öffentliche Präsenz von Rechtsradikalen bis in Parlamente hinein und die von ihnen ausgehende Kriminalität beeinflusst insgesamt und territorial unterschiedlich das Leben der demokratisch intendierten Gesellschaft und schränkt sie in ihrem Freiheitsgehalt oft massiv ein. Die Justiz insgesamt und resp. die Strafjustiz ist im Rahmen ihres grundgesetzlichen Auftrages bestrebt einen Beitrag zu leisten, das rechtsradikal intendierte und rechtswid- rige Handeln von rechtsradikalen Organisationen und Personen zurückzuweisen. Es ist sinnvoll, schon in frühen Stadien der rechten Radikalisierung durch staatliches Handeln einzuwirken, um die Radikalisierung abzubrechen, eine (politisch) kriminelle Karriere zu verhindern und Gruppen in ihre rechtlichen Schranken zu weisen.
Besonders sinnvoll ist dies in Bezug auf Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, da die Möglichkeiten von Einflussmaßen hier stärker gegeben sind. Das betrifft das gesellschaftliche und justizielle Potenzial und Instrumentarium ebenso wie die Erfahrungen in deradikalisierender Intervention. So kann beispielsweise über Sanktionen eine Wirkung erzielt werden. Gerade weniger Radikalisierte sollten im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten eher mit Instrumenten angesprochen werden, die nicht auf Freiheitsentzug abzielen, wenn denn die Wirkungsbedingungen beachtet werden und entsprechende deradikalisierend angelegte Brücken gebaut werden. Dazu können Auflagen und Weisungen dienen. Im Falle von Kriminalität, die in ihrem Gehalt eine Funktion des Rechtsradikalen (rechtsradikale Kriminalität) darstellt, ist das Strafrecht direkt in der Pflicht, sein soziales Potenzial auf die Intentionalität dieser Art von Kriminalität generalpräventiv wie rückfallverhütend auszurichten. Dabei geht es nicht nur um als Staatsschutzdelikte deklarierte Handlungen, sondern um jene Straftaten, deren intentionaler Impetus in eine rechtsradikale Richtung verweist. Diese Qualifizierung ist in der Praxis nicht immer leicht, liegt aber bei näherem und kenntnisreichem Hinsehen oft auf der Hand, woraus sich eine spezifische Vorgehensweise im Strafverfahren ergeben kann. Die Einstufung als Staatsschutzdelikt nach den kriminalstatistischen Kriterien der Polizeien gibt dafür besondere Hinweise. Angesichts der Tatsache, dass auch rechtsradikale Kriminalität unterschiedliche Merkmale sozialer Schädlichkeit aufweist, ergibt sich daraus, dass die Strafrechtsprechung unterschiedliche Sanktionen bereitzuhalten hat und verschiedene individualisiert angelegte erzieherische Instrumente einsetzt. Im Falle von jugendlichen und jungerwachsenen Rechtsradikalen und ihren freiheitsfeindlichen Straftaten gilt das in einem besonderen Maße, um unnötige Radikalisierungen durch hyperventilierende Repression zu vermeiden und zugleich Lernpfade demokratischer und menschenrecht- lich imperativer Valenz zu legen. In dieses Spektrum gehören Auflagen und Weisungen. Im Folgenden sollen zur Wirksamkeit dieser juristischen Instrumente Erfahrungen dargelegt werden, die in der Strafrechtsprechung gewonnen wurden und durch Aussteiger aus der rechtsradikalen Szene bewertet werden. Zu diesem Zweck wurden 201 Amtsträger bundesweit in unterschiedlichen Funktionen im Strafverfahren angesprochen und auflaufende Erfahrungen zur Wirkung der Instrumente und den Kriterien ihrer Anwendung aufgenommen. Zugleich wurden aus 503 Ausstiegsfälle sachliche Verwertbarkeiten herausgefiltert und verarbeitet sowie mit 10 Aussteigern intensive Auswertungen, darunter ein Gruppengespräch, durchgeführt. Ihre Erfahrungen wurden über den individuellen Fall der jeweiligen Strafverfahren hinaus ausgewertet, da sie durch ihre ehemals herausgehobenen Funktionen im rechtsradikalen Kontext weitergehende Überblicke besaßen. Bei der Arbeit handelt es sich um keine elaborierte Studie, sondern um ein Pilotprojekt, um einen Einstieg in ein systematisches, forschungsrelevantes und praktisches Vorgehen anzulegen und den dazu erforderlichen Diskurs zu intensivieren und inhaltlich anzureichern. Aus den vorliegenden Ergebnissen werden Erfahrungen zusammengefasst und einige Vorschläge unterbreitet, wie mit Auflagen und Weisungen im Hinblick auf eine deradikalisierende Wirkung rechtsradikaler Täter umgegangen werden kann und welche Probleme dabei bestehen, welche Bedingungen sowie Angebote dabei von Belang sein können. Es sollen Anregungen gegeben werden, die dazu beitragen können, die Qualität und Wirksamkeit von Sanktionen in der Praxis der staatlichen Institutionen und freien Träger zu erhöhen. Dabei ist es vorteilhaft die Prozesse von ihrem Ende her zu denken, das heißt in diesem Fall von dem Zustand der Deradikalisiertheit des ehemals straffälligen Rechtsradikalen ausgehend, der seine Taten als Funktion seiner Radikalität ausführte. Jene, die diesen Zustand mit einer basalen Reflektiertheit für sich erreicht haben – so zeigen die langjährigen Erfahrungen von EXIT-Deutschland – treten nicht mehr mit rechtsradikalen Delikten hervor.
Die Arbeit wurde im Jahr 2013 durch die Ministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger angeregt und durch das Bundesministerium der Justiz gefördert. Dafür möchte sich das Projektteam, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der ‚ZDK Gesellschaft Demokratische Kultur gGmbH / Initiative EXIT-Deutschland‘ und ehemalige Mitglieder militanter rechtsradikaler Organisationen des ‚Aktionskreises ehemaliger Extremisten‘ bei ‚EXIT-Deutschland‘ bedanken. Das Team hofft, dass die Arbeit neue Impulse in der Auseinandersetzung mit dem Rechtsradikalismus setzt.
Bernd Wagner