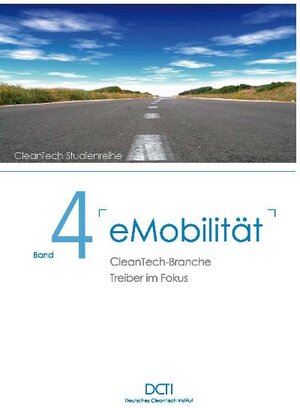
×
![Buchcover ISBN 9783942292108]()
Band 4 | eMobilität
CleanTech-Branche | Treiber im Fokus
von Martin Jendrischik und Jürgen Hüpohl, Vorwort von Philipp WolffAuszug
Elektrofahrzeuge sind keineswegs eine Erfindung der letzten Jahre, in denen der Klimawandel die öffentliche Diskussion und die Wahrnehmung von erdölgetriebener Mobilität intensiv bestimmt hat – vielmehr gab es schon weit vor dem Otto-Verbrennungsmotor erste Versuche, Fahrzeuge elektrisch anzutreiben. Dabei stand anfangs nicht der heute dominierende ökologische Gedanke im Vordergrund, sondern die größere Effizienz des Elektromotors im Vergleich zum Verbrennungsmotor. Reichen die eMotoren in ihren Wirkungsgraden nahe an 100%, kommen Dieselmotoren auf gerade einmal 40% und Benziner gar nur auf 30% Wirkungsgrad.Trotz dieser schon früh erkannten und bekannten Vorteile der elektrischen Antriebe wurde vornehmlich die Frage der Energiespeicherung zum Hindernis für eine flächendeckende elektronische Mobilität im Individualverkehr. Zwar stehen inzwischen dank modernster Technologien deutlich leistungsfähigere und damit auch reichweitenstärkere Energiespeicher zur Verfügung, doch die grundlegenden Probleme der bislang mangelnden Lade-Infrastruktur sowie der ausreichenden Energiespeicherung gelten auch heute noch als Achillesferse der eMobilität.
Differierende Konzepte und Ansätze der eMobilität werden im Folgenden eingehend erläutert und exemplarisch auf ihre Potentiale und etwaige Problemfelder hin abgeklopft. Prinzipiell liegt in der adäquaten Bereitstellung der notwendigen Antriebsenergie auch heute noch der Schlüssel für den dringend erforderlichen Paradigmenwechsel innerhalb der Automobilbranche. Somit sind Fahrzeughersteller, aber auch Zulieferbetriebe und Sekundärindustrien – etwa Hersteller von Ladestationen, Batterien oder Antriebskomponenten – gefordert, gemeinsame Lösungen zu entwickeln.
Denn: Nicht nur die wichtige Frage nach einer zukünftig klimaschonenden, emissionsarmen individuellen Mobilität oder der geopolitische Wunsch nach größerer Unabhängigkeit von erdölexportierenden Ländern spielt dabei eine zentrale Rolle. Auch die nationalstaatlichen und europaweiten Verpflichtungen zur CO2-Reduktion – die EU-Vorgabe für neue PKW sind 120 g/kg für Neufahrzeuge bis 2015 – fordern auch der Automobilbranche einen Beitrag ab. Alleine mit sparsameren Verbrennungsmotoren kann die Automobilbranche diesen Forderungen allerdings nicht nachkommen [Wagner vom Berg et. al., S. 973]. Vielmehr ist der Paradigmenwechsel hin zur Elektromobilität dringend geboten, um die individuelle Mobilität insgesamt effizienter und emissionsfreier zu machen. Dabei ist die Verwendung von Elektromotoren, die ihre Energie über regenerative Energiequellen beziehen, eine ganz zentrale Säule.
Ein solcher Paradigmenwechsel bedeutet aber auch, dass sich die Gewichte innerhalb der Automobilbranche verschieben und sich damit insbesondere die Wertschöpfungsstufen verändern werden. Neue Marktteilnehmer und technologiegetriebene Start-ups greifen künftig ebenso ein wie Unternehmen aus den Bereichen Informations- und Kommunikationstechnologie oder die Energieversorger, die durch einen solchen Wandel zu Anbietern des „Treibstoffs“ einer zunehmend mobileren Gesellschaft werden. Unternehmen wie Tesla Motors aus den USA sind zudem schon heute wichtige Partner von internationalen Branchengrößen wie Toyota oder dem Daimler-Konzern. Doch nur in engen, branchenübergreifenden Kooperationen lassen sich neue Geschäftsmodelle, etwa im Bereich der notwendigen Infrastruktur für Stromfahrzeuge, nachhaltig entwickeln – und so schließlich vollkommen neue Mobilitätskonzepte durchsetzen.
Unterstützt wird die Wiederentdeckung des erstmals im frühen 19. Jahrhundert entwickelten Elektromotors, dem Branchenkenner heutzutage gute Zukunftsaussichten einräumen, durch den gesellschaftlichen Wandel und die insgesamt steigende Akzeptanz für alternative Fortbewegung in den Industrienationen. Stark schwankende und tendenziell steigende Erdölpreise, das Wissen um die immer knapperen Ölreserven und der politisch motivierte Wunsch nach größerer Unabhängigkeit von den erdölexportierenden Staaten führen, gepaart mit einem zunehmenden Bewusstsein für notwendige Strategien gegen den Klimawandel, zu der stetig wachsenden Nachfrage und zunehmenden Serienreife von Elektrofahrzeugen.
Zudem entwickeln sich auch in benachbarten, teils sogar in entfernten Industriesegmenten, immer neue Anwendungen und Applikationen, die die individuelle eMobilität unterstützen. Die Vernetzung von Smart-Phones mit der öffentlichen Lade-Infrastruktur für Elektroautos, Pedelecs oder eBikes gehört ebenso dazu wie die Abstimmung einer dezentraler werdenden Energieversorgung mit dem intelligenten Stromnetz oder die intelligente Weiterentwicklung und Bedarfsanpassung von Stellplätzen, Carports oder privaten und öffentlichen Garagen. Doch bei aller Euphorie und erfreulicher Geschäftsfelderweiterung der unterschiedlichen Industrien mit Blick auf künftige Mobilitätskonzepte, wird sich die eMobilität nicht von heute auf morgen durchsetzen. Auf absehbare Zeit werden sowohl Verbrennungsmotoren als auch die heute schon serienreifen Hybridfahrzeuge neben den noch eher exotischen Elektro- und Brennstoffzellen-Fahrzeugen existieren [Zetsche, S. 2].
eMobilität ist in ihrer Gesamtheit weit mehr als die bloße Verwendung eines elektrischen Antriebs für Automobile, die sich in Aussehen und Nutzerverhalten nicht wesentlich von diesel- oder benzingetriebenen Fahrzeugen absetzen. eMobilität bedeutet auch eine stärker an den individuellen Bedarf angepasste und damit effizientere Fahrzeugnutzung. Car-Sharing, die Nutzung von Pedelecs für kurze innerstädtische Fahrten und nicht zuletzt die Abkehr von dem Gedanken, ein Auto müsse möglichst leistungsstark und sperrig sein, sollte ebenso Teil zukünftiger, vernetzter und ganzheitlicher Mobilitätskonzepte sein. Dabei darf sich der Blick nicht nur auf die heute dominierenden Industrienationen in Europa, Nord-Amerika und einige wenige Teile Asiens beschränken, sondern muss gerade die künftigen Wachstumsmärkte und bevölkerungsreichen Nationen berücksichtigen. So werden die Schwellenländer China und Indien das weltweite Verständnis, aber auch die zukünftigen Anforderungen an Mobilitätskonzepte, entscheidend prägen. Denn mit den hier neu entstehenden Bedarfen an individueller Mobilität eröffnet sich auch für die eMobilität ein Marktpotential mit ungeahnten Ausmaßen. Aktuellen Prognosen zufolge wird der weltweite PKW-Bestand bis 2030 um etwa das 4,5-fache zunehmen [Wagner vom Berg, et. al., S. 973]. Angesichts steigender Ölpreise und zunehmender Klimaerwärmung drängen sich hier neue, zukunftsfähige Fortbewegungskonzepte regelrecht auf.
Damit stellt sich weniger die Frage danach, ob der Wandel zur eMobilität zeitnah vollzogen wird, sondern eher die Frage, wie schnell sich eine solche Umstellung durchsetzen lässt. Der Studienband eMobilität versucht sich diesen Fragestellungen zu nähern, formuliert erste Lösungsansätzen und gibt einen Einblick in die Chancen und Potentiale der neuen Antriebs- und Fortbewegungskonzepte, ohne dabei Hindernisse, Probleme und Herausforderungen zu verschweigen. Mögliche Zukunftsszenarien und das Aufzeigen von Perspektiven für die Elektromobilität runden die Studie ab.



