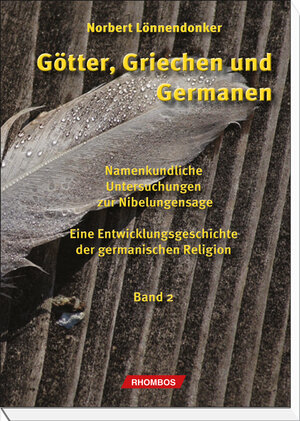Götter, Griechen und Germanen
Namenkundliche Untersuchungen zur Nibelungensage, Band 2. Eine Entwicklungsgeschichte der germanischen Religion.
von Norbert LönnendonkerNorbert Lönnendonker
Götter, Griechen und Germanen.
Namenkundliche Untersuchungen zur Nibelungensage, Band 2.
Eine Entwicklungsgeschichte der germanischen Religion.
400 Seiten, Din A5, 45 Abbildungen, 7 Tabellen. Broschur. ISBN: 978-3-941216-76-1. Preis: 28,00 Euro. RHOMBOS-VERLAG, Berlin 2013
Die Bände 2 und 3 dieser Trilogie beschäftigen sich vornehmlich mit mythologischen Fragen, die zum Ergebnis haben, dass die sogenannten „Heldennamen“ im Sinne Hermann Useners „abgelegte Götternamen“ und „abgelegte Götterbeinamen“ sind. Die Namen der Götter waren in der Frühzeit bedeutend zahlreicher, als uns das aus der griechischen Antike bewusst ist, aber die griechische Religion kennen wir auch „lediglich“ aus der Sicht Homers und Hesiods; die Religion des Volkes kennen wir im Allgemeinen nicht. Diskutiert werden die Namen der „Helden“: Walther, Gunther, Siegfried, Hagen (von Tronje), Hamlet, Viglet, Detleif der Däne, Ermenrich, Attila und „verschiedene“ 'Hildas'. Weiter finden sich die „Helden“ Sintram, Herbort (Herburt) und Herdegen, von welchen einer wiederum mit einer Hilda zusammenkommt. Wie in den Kapiteln der Bände 2 und 3 dargestellt wird, ergeben sich häufig Berührungen mit einer anderen Toponymie von Kultorten germanischer und keltischer Gottheiten. Das Ortsnamengerüst (der Kudrun- und der Thidrekssaga) bleibt bis auf Ausnahmen zeitlich auf die Jahre zwischen 800 und 1200 n. Chr. beschränkt. Es spiegelt also in Bezug auf die Schreibweisen die Zeit der mutmaßlichen Verschriftlichungen von Teilen der Sage wider. Zweisprachigkeit – keltisch, germanisch – bleibt eine zum Teil belegte Möglichkeit.
400 Seiten, Din A5, 45 Abbildungen, 7 Tabellen. Broschur. ISBN: 978-3-941216-76-1. Preis: 28,00 Euro. RHOMBOS-VERLAG, Berlin 2013
Die Bände 2 und 3 dieser Trilogie beschäftigen sich vornehmlich mit mythologischen Fragen, die zum Ergebnis haben, dass die sogenannten „Heldennamen“ im Sinne Hermann Useners „abgelegte Götternamen“ und „abgelegte Götterbeinamen“ sind. Die Namen der Götter waren in der Frühzeit bedeutend zahlreicher, als uns das aus der griechischen Antike bewusst ist, aber die griechische Religion kennen wir auch „lediglich“ aus der Sicht Homers und Hesiods; die Religion des Volkes kennen wir im Allgemeinen nicht. Diskutiert werden die Namen der „Helden“: Walther, Gunther, Siegfried, Hagen (von Tronje), Hamlet, Viglet, Detleif der Däne, Ermenrich, Attila und „verschiedene“ 'Hildas'. Weiter finden sich die „Helden“ Sintram, Herbort (Herburt) und Herdegen, von welchen einer wiederum mit einer Hilda zusammenkommt. Wie in den Kapiteln der Bände 2 und 3 dargestellt wird, ergeben sich häufig Berührungen mit einer anderen Toponymie von Kultorten germanischer und keltischer Gottheiten. Das Ortsnamengerüst (der Kudrun- und der Thidrekssaga) bleibt bis auf Ausnahmen zeitlich auf die Jahre zwischen 800 und 1200 n. Chr. beschränkt. Es spiegelt also in Bezug auf die Schreibweisen die Zeit der mutmaßlichen Verschriftlichungen von Teilen der Sage wider. Zweisprachigkeit – keltisch, germanisch – bleibt eine zum Teil belegte Möglichkeit.