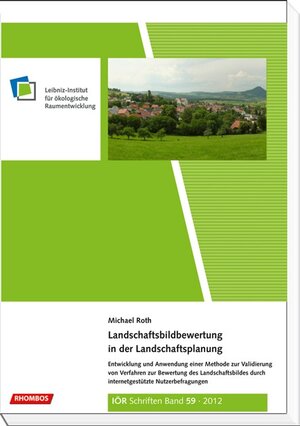Landschaftsbildbewertung in der Landschaftsplanung
Entwicklung und Anwendung einer Methode zur Validierung von Verfahren zur Bewertung des Landschaftsbildes durch internetgestützte Nutzerbefragungen
von Michael RothMichael Roth
Landschaftsbildbewertung in der Landschaftsplanung
Entwicklung und Anwendung einer Methode zur Validierung von Verfahren zur Bewertung des Landschaftsbildes durch internetgestützte Nutzerbefragungen
280 Seiten. Zahlr. Abbildungen und Tabellen, mehr als 21 davon farbig. Preis: 39,80 Euro ISBN: 978-3-941216-69-3 Rhombos-Verlag, Berlin 2012 Band 59 der Reihe „IÖR Schriften“, herausgegeben vom Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung e. V. (IÖR)
Direktor: Prof. Dr. Dr. h. c. Bernhard Müller Weberplatz 1, 01217 Dresden Tel.: (0351) 4679-0, Fax.: (0351) 4679-212 E-Mail: info@ioer. de, Homepage: http://www. ioer. de
Die Bewertung des Schutzgutes Landschaftsbild wird in Wissenschaft, Planungs- und Verwaltungspraxis oft als problematisch wahrgenommen, da nur ein geringer Kenntnisstand zur Bearbeiterunabhängigkeit, Zuverlässigkeit bzw. Reproduzierbarkeit und Gültigkeit von Landschaftsbildbewertungsmethoden vorherrscht. Dies konnte im Rahmen der vorliegenden Dissertation sowohl durch eine Recherche und Analyse von über 200 publizierten Methoden zur Bewertung des Landschaftsbildes als auch durch die Analyse einer repräsentativen Stichprobe von mehr als 120 Landschaftsplänen auf kommunaler Ebene nachgewiesen werden. Durch die Entwicklung eines auf Methoden der psychologischen Onlineforschung und Online-Marktforschung basierenden Instruments zur Internetbewertung von Landschaftsbildern steht ein Tool zur Erfassung einer großen Zahl (in einem ersten Pretest über 300 Teilnehmer) nutzerbasierter Landschaftsbildbewertungen von hinsichtlich Altersstruktur, Bildungsniveau und geographischer Verteilung sehr diversen Stichproben zur Verfügung, das sich in empirischen Pretests als bewerterunabhängig, reproduzierbar und gültig zur Erfassung von Landschaftsbildbewertungen erwies. Im Internet erfasste Landschaftsbildbewertungen wurden zur Untersuchung der Validität zweier in der kommunalen Landschaftsplanung gebräuchlicher Expertenverfahren zur Bewertung des Landschaftsbildes eingesetzt. Erstmals liegen somit für die beiden untersuchten Bewertungsverfahren Einschätzungen der wissenschaftlichen Güte bzw. Gültigkeit, basierend auf einer breiten empirischen Datenbasis (mit über 1.600 Teilnehmern in der Hauptuntersuchung) vor. Basierend auf den erzielten Ergebnissen werden Empfehlungen zum Einsatz von Landschaftsbildbewertungsverfahren gegeben. In academia, practical landscape planning and administrative procedures, the assessment of visual landscape quality is considered to be problematic due to the lack of knowledge on the objectivity, reliability and validity of the methods applied. In this dissertation, the current state of visual landscape assessment both in academic literature and in practical landscape planning is critically analyzed. A validation tool using Internet survey methods has been developed and applied to two visual landscape quality assessment methods. Based on the findings of these analyses, recommendations for the assessment of visual landscape qualities are given. Vorwort
Das „Landschaftsbild“ ist seit jeher eines der Schutzgüter des Natur- und Umweltschutzes, das sich nicht nur Experten erschließt, sondern auch Laien unmittelbar und emotional anspricht. Es ist daher kein Zufall, dass der Ausgangspunkt für die historische Entwicklung des Natur- und Umweltschutzes ausgerechnet die „Schönheit der Landschaft“ war. Mit der Gründung sogenannter „Verschönerungsvereine“ wurde bereits in preußischer Zeit (zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts) versucht, ästhetisch besonders ansprechende Landschaften zu schützen und erforderlichenfalls wiederherzustellen. In den vergangenen 150 Jahren hat sich die Landschaft in- und außerhalb Deutschlands dramatisch verändert. Städte haben sich zu Agglomerationen ausgewachsen, Verkehrsinfrastruktur prägt durch weithin sichtbare Brückenbauwerke die Landschaft auch im unbesiedelten Bereich. Dennoch gibt es sie noch immer: die attraktiven Landschaften von herausragender Schönheit, hoher Vielfalt und/oder spezifischer Eigenart, die des institutionellen Schutzes bedürfen, sollen sie nicht gänzlich verschwinden. Derzeit erleben wir eine neue Welle der Veränderung des Landschaftsbildes in Deutschland. Windkraft-anlagen, Photovoltaikanlagen und der Ausbau von Stromtrassen sollen nicht nur den Atomausstieg möglich machen, sondern werden auf absehbare Zeit zur Veränderung der visuellen Qualität von Landschaften beitragen. Das „Landschaftsbild“ ist folglich immer noch ein relevantes Schutzgut, das in Verbindung mit dem Tourismus inzwischen in vielen Regionen eine erhebliche wirtschaftliche Bedeutung erlangt hat. Michael Roth widmet sich in seiner Dissertationsschrift, die an der Fakultät Raumplanung der TU Dortmund eingereicht wurde, der aus wissenschaftlicher Sicht sehr bedeutsamen, in der Planungspraxis aber leider zu Unrecht vernachlässigten Problem- und Fragestellung der Validität von Methoden zur Bewertung des Landschaftsbildes. Dieses Themenfeld ist vergleichsweise speziell und daher gut abgegrenzt, dennoch existieren bisher nur wenige Arbeiten, die über eine hermeneutische Interpretation theoretischer Ansätze, wie z. B. der Ästhetiktheorie, hinausgehen. Auch hat es gelegentlich Arbeiten gegeben, die sich mit der Implementation von Landschaftsbildaspekten in der Planungspraxis befassen, leider meist ohne dass die Repräsentativität der jeweiligen Datengrundlage kritisch reflektiert, geschweige denn geprüft worden wäre. Diese unbefriedigende Situation hat gelegentlich sogar die Auffassung genährt, das Landschaftsbild entziehe sich aufgrund seiner subjektiven Dimension einer rationalen, objektiven oder wissenschaftlichen Beurteilung, so dass es keine validen Landschaftsbildbewertungsmethoden geben könne. Vor dem Hintergrund der dargestellten, für diesen Themenkomplex nicht ganz unproblematischen Situation, kommt der Dissertation von Michael Roth eine extrem hohe Bedeutung zu, da er auf der Grundlage empirischer Daten mithilfe inferenzstatistischer Methoden Aussagen generieren kann, die hinsichtlich ihrer wissenschaftlichen Qualität bisherige Dissertationen zu diesem Themenfeld bei weitem übertreffen. Auch in Bezug auf die Integration neuer Technologien für die Onlineforschung, speziell der Internetbefragung, ist der Ansatz von Roth sehr innovativ, so dass die Arbeit insgesamt einen „Quantensprung“ in der Landschaftsbildbewertung darstellt. Hauptverdienst des Autors ist es, ein wissenschaftliches Instrumentarium entwickelt zu haben, mit dem ausgewählte Landschaftsbildbewertungsverfahren validiert werden können. Darüber hinausgehend enthält die Dissertation eine Vielzahl weiterer bedeutsamer Erkenntnisse und neuer Informationen, so dass die Arbeit ein äußerst gelungenes und lesenswertes Opus darstellt, das im Übrigen vor kurzem mit dem Rudolf-Chaudoire-Forschungspreis der TU Dortmund ausgezeichnet wurde. Dieser Preis wurde aus dem Vermächtnis eines im Ruhrgebiet ansässigen Industriellen gestiftet und prämiert herausragende junge Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen für Ihre Arbeit. Es bleibt zu wünschen, dass die Dissertation von Michael Roth auch in der Planungspraxis eine entsprechende Anerkennung erfährt, damit zukünftige Entscheidungen im Rahmen von Planungsvorhaben, die sich auf das Landschaftsbild auswirken, sachgerecht und nachvollziehbar getroffen werden können.
Dortmund, im Juli 2012
Univ.-Prof. Dr. Dietwald Gruehn, TU Dortmund
280 Seiten. Zahlr. Abbildungen und Tabellen, mehr als 21 davon farbig. Preis: 39,80 Euro ISBN: 978-3-941216-69-3 Rhombos-Verlag, Berlin 2012 Band 59 der Reihe „IÖR Schriften“, herausgegeben vom Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung e. V. (IÖR)
Direktor: Prof. Dr. Dr. h. c. Bernhard Müller Weberplatz 1, 01217 Dresden Tel.: (0351) 4679-0, Fax.: (0351) 4679-212 E-Mail: info@ioer. de, Homepage: http://www. ioer. de
Die Bewertung des Schutzgutes Landschaftsbild wird in Wissenschaft, Planungs- und Verwaltungspraxis oft als problematisch wahrgenommen, da nur ein geringer Kenntnisstand zur Bearbeiterunabhängigkeit, Zuverlässigkeit bzw. Reproduzierbarkeit und Gültigkeit von Landschaftsbildbewertungsmethoden vorherrscht. Dies konnte im Rahmen der vorliegenden Dissertation sowohl durch eine Recherche und Analyse von über 200 publizierten Methoden zur Bewertung des Landschaftsbildes als auch durch die Analyse einer repräsentativen Stichprobe von mehr als 120 Landschaftsplänen auf kommunaler Ebene nachgewiesen werden. Durch die Entwicklung eines auf Methoden der psychologischen Onlineforschung und Online-Marktforschung basierenden Instruments zur Internetbewertung von Landschaftsbildern steht ein Tool zur Erfassung einer großen Zahl (in einem ersten Pretest über 300 Teilnehmer) nutzerbasierter Landschaftsbildbewertungen von hinsichtlich Altersstruktur, Bildungsniveau und geographischer Verteilung sehr diversen Stichproben zur Verfügung, das sich in empirischen Pretests als bewerterunabhängig, reproduzierbar und gültig zur Erfassung von Landschaftsbildbewertungen erwies. Im Internet erfasste Landschaftsbildbewertungen wurden zur Untersuchung der Validität zweier in der kommunalen Landschaftsplanung gebräuchlicher Expertenverfahren zur Bewertung des Landschaftsbildes eingesetzt. Erstmals liegen somit für die beiden untersuchten Bewertungsverfahren Einschätzungen der wissenschaftlichen Güte bzw. Gültigkeit, basierend auf einer breiten empirischen Datenbasis (mit über 1.600 Teilnehmern in der Hauptuntersuchung) vor. Basierend auf den erzielten Ergebnissen werden Empfehlungen zum Einsatz von Landschaftsbildbewertungsverfahren gegeben. In academia, practical landscape planning and administrative procedures, the assessment of visual landscape quality is considered to be problematic due to the lack of knowledge on the objectivity, reliability and validity of the methods applied. In this dissertation, the current state of visual landscape assessment both in academic literature and in practical landscape planning is critically analyzed. A validation tool using Internet survey methods has been developed and applied to two visual landscape quality assessment methods. Based on the findings of these analyses, recommendations for the assessment of visual landscape qualities are given. Vorwort
Das „Landschaftsbild“ ist seit jeher eines der Schutzgüter des Natur- und Umweltschutzes, das sich nicht nur Experten erschließt, sondern auch Laien unmittelbar und emotional anspricht. Es ist daher kein Zufall, dass der Ausgangspunkt für die historische Entwicklung des Natur- und Umweltschutzes ausgerechnet die „Schönheit der Landschaft“ war. Mit der Gründung sogenannter „Verschönerungsvereine“ wurde bereits in preußischer Zeit (zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts) versucht, ästhetisch besonders ansprechende Landschaften zu schützen und erforderlichenfalls wiederherzustellen. In den vergangenen 150 Jahren hat sich die Landschaft in- und außerhalb Deutschlands dramatisch verändert. Städte haben sich zu Agglomerationen ausgewachsen, Verkehrsinfrastruktur prägt durch weithin sichtbare Brückenbauwerke die Landschaft auch im unbesiedelten Bereich. Dennoch gibt es sie noch immer: die attraktiven Landschaften von herausragender Schönheit, hoher Vielfalt und/oder spezifischer Eigenart, die des institutionellen Schutzes bedürfen, sollen sie nicht gänzlich verschwinden. Derzeit erleben wir eine neue Welle der Veränderung des Landschaftsbildes in Deutschland. Windkraft-anlagen, Photovoltaikanlagen und der Ausbau von Stromtrassen sollen nicht nur den Atomausstieg möglich machen, sondern werden auf absehbare Zeit zur Veränderung der visuellen Qualität von Landschaften beitragen. Das „Landschaftsbild“ ist folglich immer noch ein relevantes Schutzgut, das in Verbindung mit dem Tourismus inzwischen in vielen Regionen eine erhebliche wirtschaftliche Bedeutung erlangt hat. Michael Roth widmet sich in seiner Dissertationsschrift, die an der Fakultät Raumplanung der TU Dortmund eingereicht wurde, der aus wissenschaftlicher Sicht sehr bedeutsamen, in der Planungspraxis aber leider zu Unrecht vernachlässigten Problem- und Fragestellung der Validität von Methoden zur Bewertung des Landschaftsbildes. Dieses Themenfeld ist vergleichsweise speziell und daher gut abgegrenzt, dennoch existieren bisher nur wenige Arbeiten, die über eine hermeneutische Interpretation theoretischer Ansätze, wie z. B. der Ästhetiktheorie, hinausgehen. Auch hat es gelegentlich Arbeiten gegeben, die sich mit der Implementation von Landschaftsbildaspekten in der Planungspraxis befassen, leider meist ohne dass die Repräsentativität der jeweiligen Datengrundlage kritisch reflektiert, geschweige denn geprüft worden wäre. Diese unbefriedigende Situation hat gelegentlich sogar die Auffassung genährt, das Landschaftsbild entziehe sich aufgrund seiner subjektiven Dimension einer rationalen, objektiven oder wissenschaftlichen Beurteilung, so dass es keine validen Landschaftsbildbewertungsmethoden geben könne. Vor dem Hintergrund der dargestellten, für diesen Themenkomplex nicht ganz unproblematischen Situation, kommt der Dissertation von Michael Roth eine extrem hohe Bedeutung zu, da er auf der Grundlage empirischer Daten mithilfe inferenzstatistischer Methoden Aussagen generieren kann, die hinsichtlich ihrer wissenschaftlichen Qualität bisherige Dissertationen zu diesem Themenfeld bei weitem übertreffen. Auch in Bezug auf die Integration neuer Technologien für die Onlineforschung, speziell der Internetbefragung, ist der Ansatz von Roth sehr innovativ, so dass die Arbeit insgesamt einen „Quantensprung“ in der Landschaftsbildbewertung darstellt. Hauptverdienst des Autors ist es, ein wissenschaftliches Instrumentarium entwickelt zu haben, mit dem ausgewählte Landschaftsbildbewertungsverfahren validiert werden können. Darüber hinausgehend enthält die Dissertation eine Vielzahl weiterer bedeutsamer Erkenntnisse und neuer Informationen, so dass die Arbeit ein äußerst gelungenes und lesenswertes Opus darstellt, das im Übrigen vor kurzem mit dem Rudolf-Chaudoire-Forschungspreis der TU Dortmund ausgezeichnet wurde. Dieser Preis wurde aus dem Vermächtnis eines im Ruhrgebiet ansässigen Industriellen gestiftet und prämiert herausragende junge Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen für Ihre Arbeit. Es bleibt zu wünschen, dass die Dissertation von Michael Roth auch in der Planungspraxis eine entsprechende Anerkennung erfährt, damit zukünftige Entscheidungen im Rahmen von Planungsvorhaben, die sich auf das Landschaftsbild auswirken, sachgerecht und nachvollziehbar getroffen werden können.
Dortmund, im Juli 2012
Univ.-Prof. Dr. Dietwald Gruehn, TU Dortmund