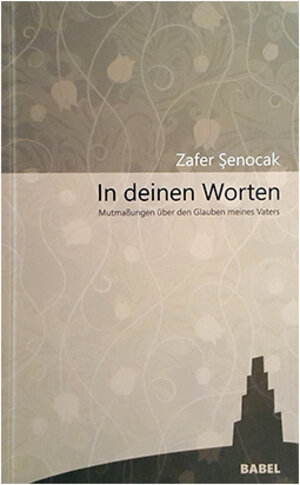
×
![Buchcover ISBN 9783928551410]()
Auszug
PrologMein Vater war ein Publizist und Verleger, der sein ganzes Lebenswerk dem Islam gewidmet hat. Ende der Sechziger Jahre verließ er seine Heimat, die Türkei, um nach Deutschland, wie er es nannte, in das Land des Nedjaschi auszuwandern. „Nedjaschi“ klang natürlich exotischer und geheimnisvoller in den Ohren als „deutsch“ oder „Deutschland“. Es war eine der Figuren aus meiner Kindheit, die Märchen und Wirklichkeit, Vergangenheit und Gegenwart vereinten und mich in fremde Welten entführten. Nedjaschi war ein frühchristlicher König aus Abessinien gewesen, dessen Ruhm als gerechter Herrscher über Zeiten und Grenzen reichte und sprichwörtlich geworden war. Er hatte den ersten Muslimen von Mekka, die von ihrer Gemeinschaft verfolgt wurden, Zuflucht geboten. So war der Islam meiner Kindheit der Glaube von Zufluchtsuchenden. Diese Zuflucht hatten sie bei einem Herrscher fremden Glaubens gefunden. Weder waren sie raubgierige Eindringlinge, noch waren sie auf einem Rachefeldzug gewesen. Die Schurken in meiner Kindheit dagegen hatten eher das Format von Räuber Hotzenplotz.
Deutschland war für meinen Vater der Ort, wo der Rechtsstaat funktionierte. In der islamischen Welt aber gab es keinen einzigen Rechtsstaat. Diese Diskrepanz zwischen dem Anspruch seines Glaubens, ein von Recht geleitetes und Glück versprechendes Leben unter die Menschen zu bringen, und der von Unrecht und Leid bestimmten Wirklichkeit beschäftigte meinen Vater sein ganzes Leben lang. Er wollte diesem aus seiner Sicht selbstverschuldeten Unglück der Muslime von Deutschland aus nachgehen, wo er frei und unbedroht leben und arbeiten konnte.
Wir ließen uns also Ende der 1960er Jahre im bürgerlichen Münchner Süden nieder, wo mein Vater auch sein Büro einrichtete, seine Arbeiten niederschrieb, an seinen Abhandlungen und Polemiken feilte und islamische Literatur publizierte. Am Klingelschild stand „Islamischer Verlag“. Nichts war geheim. Islam war noch kein Etikett der Identität. In der Türkei gab es noch keine langen Vollbärte und nur wenige verschleierte Frauen. Die meisten Türken bemühten sich, wie Mitteleuropäer auszusehen.
Die Muslime, die nach Deutschland kamen, fielen äußerlich nicht sonderlich auf. Der Islam in meiner Kindheit hatte vielleicht einen öligen Beigeschmack, weil reiche Scheichs aus Arabien angefangen hatten, mit unvorstellbar hohen Summen in Europa zu investieren und zu konsumieren. Doch bei den meisten Deutschen löste diese fremde Religion Assoziationen aus, die noch immer eher zur Tausendundeiner Nacht führten. Es gibt ja diese alte Verbindung zum Islam in der deutschen Geistesgeschichte. Nicht nur Goethe hat sich intensiv mit dem Orient beschäftigt. In der deutschen Romantik finden sich immer wieder Autoren, die von anderen Kulturen fasziniert waren. Aber auch in der beginnenden Moderne einen Dichter wie Klabund, der einen poetischen Mohammed-Roman verfasste. Die Popularität von Märchen und Volkssagen hatte auch viel mit der Faszination des Fremden zu tun.
Und es gab noch eine Verbindung zur muslimisch-türkischen Kultur im damaligen Deutschland: Denn zu der Zeit als meine Familie nach Deutschland zog, lebten noch etliche derer, die während des Ersten Weltkrieges unter der Osmanischen Flagge für die Türkei, dem Verbündeten des Deutschen Reiches gekämpft hatten. Einige besaßen noch Gegenstände aus dieser Zeit, eine Kupferschale, ein paar Erinnerungsfotos, die den jungen Soldaten auf einem Kamel zeigten, oder einen Wandteppich mit Rosenmustern. Ihre Erinnerungen aber hatte der Zweite Weltkrieg kassiert.
Mit den Türken, die seit den frühen 1960ern nach Deutschland kamen, wurden diese Erinnerungen wieder wachgerufen. Diese Türken wurden „Gastarbeiter“ genannt. So als würde man einen Gast in die Küche schicken, um den Abwasch zu erledigen. Auf ältlichen Schwarzweiß-Photos sieht man sie immer korrekt gekleidet, die Männer tragen Krawatten, die Frauen Bleistiftröcke und ganz selten ein Kopftuch. Damals träumten sie alle von einem besseren Leben. Europäisch zu sein war damals in Mode, gleichbedeutend mit Wohlstand und westlichem Lebensstil. Kaum einer von diesen „Gastarbeitern“ hätte gedacht, dass die Enkel einmal in Deutschland geboren würden. Heute stellt sich die Frage, warum manche unter diesen Enkeln nicht mehr den Traum der Großeltern träumen? Doch ist das Träumen vererbbar? Ist es nicht auch etwas Natürliches, frage ich mich, ein Spiel zwischen den Generationen, mit eigenen, sich wiederholenden Regeln, wenn die dritte Generation sich distanziert von der Anpassung der Väter und Vorväter? Der Islam in seiner radikalsten Form ist eine willkommene Geste der Fremdheit. Anderssein und ausgegrenzt zu werden kann auch Kultcharakter bekommen. Mit den Fragmenten des Islam kann man heute wehtun, seelisch und körperlich. Mit dem Islam kann man seine Männlichkeit spielen lassen, in einer Gesellschaft, in der sich die Frauen von der Regie des Mannes emanzipiert haben. Mit dem Islam lassen sich schlechte Schulleistungen nicht ausgleichen, aber ausblenden. Der Islam stärkt den Rücken des Rechthabers. Er ist wie ein Tweet, eine Abkürzung in einem kompliziert gewordenen, oftmals mit Umwegen und Kurven versehenen Weg des Lebens. Schlag' den Koran auf und du weißt Bescheid, über dein Leben, über deine Aufgaben, deine Stellung in einer von Gott vorgesehenen und offenbarten Ordnung.
Mein Vater hatte ganz andere Dinge im Koran gelesen. Zum Beispiel, dass man sich um die Schwachen, die im Leben Beschädigten und Benachteiligten kümmern müsse, um die Waisen und die Kranken. Die nackte Gewalt im Namen des Islam machte meinen Vater fassungslos. „Wenn die Jugendlichen sich irren, sind die Älteren immer auch schuld,“ höre ich ihn sagen. Also war auch er schuld? Schuldig an seinem Glauben?
Manchmal fragten die Nachbarn meinen Vater nach seiner Arbeit. Was für Bücher er da Tag für Tag in die Kisten packe? Sie fragten aus Neugier und mit wachem Interesse. In ihren Gesichtern war keinerlei Angst zu erkennen. Der Islam sorgte damals weder für Ablehnung noch für eine von der Furcht bestimmte Fremde. Er war vielleicht exotisch und hatte das Flair des Unbekannten. Mein Vater wurde nie angefeindet. Ich wundere mich deshalb nicht, dass die Deutschen, die heute in Dresden auf die Straße gehen, um gegen die Islamisierung Europas zu protestieren, in Köln oder in Frankfurt nicht anzutreffen sind. Dresden ist vielleicht „deutscher“ als Köln, wenn man nur die Herkunft der Menschen in Betracht zieht. Aber Dresden repräsentiert nicht mehr das heutige Deutschland. Eine Art Enklave ist diese Stadt, wie viele Städte Ostdeutschlands, fern dem multikulturellen Treiben im Westen des Landes. Was die Migration und das Zusammenleben mit fremden Kulturen angeht, hat sich die Teilung Deutschlands auch nach der Vereinigung fortgesetzt. Deutschsein im Osten wurde nicht nur sozialistisch geprägt. Es stand auch mehr in der Tradition des alten Preußen.
In Dresden fehlt die Erfahrung, die man mit meinem Vater hätte machen können. Die Erfahrung einer Begegnung mit einem Fremden, dem man hätte Fragen stellen können. Heute werden Fragen oft so gestellt, als ginge es nur darum, vorgefertigte Antworten kund zu tun. Vielleicht stellt man inzwischen auch gar keine Fragen mehr. Aus Angst oder aus vermeintlichem Wissen. So werden die Gesprächsfäden fragil oder reißen ganz ab.
Bei der Integration geht es nicht darum eine Festung zu verteidigen oder einzunehmen, sondern darum, ein Türschild anzubringen mit einem Namen, der nicht nur eine Identität ausweist, sondern der auch einen Wegweiser für die fremde Post und den noch unbekannten Besuch darstellt. Eines Tages klingelte der Pfarrer der katholischen Kirche des Stadtteils bei uns, fragte nach, ob wir etwas benötigten, wir seien ja neu und er könne sich vorstellen, dass wir die eine oder andere Frage hätten. Er saß dann eine Weile in dem noch spärlich möblierten Wohnzimmer und erzählte von sich, wie er, halb Kind, halb junger Mann seine Heimat hatte verlassen müssen. Ich verstand ihn kaum, und mein Vater übersetzte mir seine Geschichte.
Uns geht es doch gut, wir sind freiwillig in dieses Land gekommen, dachte ich mir und suchte im Atlas vergeblich nach einem Landstrich namens „Sudetenland“. Nicht nur die Menschen waren fort, auch das Land schien verschwunden zu sein.
Wenig später sah ich den Pfarrer in meiner Schule wieder. Er kam für den Religionsunterricht, von dem ich befreit war. Doch ich war viel zu neugierig, um die Freistunde auf dem verwaisten Schulhof und den halbdunklen Gängen des alten Schulgebäudes zu verbringen. Also ging ich in die Klasse, setzte mich in die hinterste Reihe und verfolgte den Unterricht. Leider erzählte der Pfarrer nichts von seiner abenteuerlichen Lebensgeschichte, die mir in Erinnerung geblieben war. Stattdessen gab es in seinen Ausführungen Vieles, was ich auch aus den Geschichten kannte, die mein Vater gerne erzählte. Bibel und Koran schienen ähnliche Geschichten zu erzählen. In ihnen tauchten die gleichen Figuren auf, so als wären die gleichen Märchen zu verschiedenen Zeiten in unterschiedlichen Sprachen erzählt worden.
Heute bemüht man sich um interreligiösen Dialog. Doch Religionen können einander nicht begegnen, ebenso wenig wie Kulturen. Zwei Menschen sind es, die sich begegnen und ein Gespräch beginnen oder auch nicht. Sie entscheiden darüber, ob sie einander grüßen, ob sie einander ihre Geschichten erzählen wollen, ob sie willens sind, dem anderen zuzuhören.
Wenn sich Muslime heute über Islamophobie beklagen, täten sie recht daran zu fragen, woher denn diese Phobie kommt. Geschieht den Muslimen Unrecht, wenn sich viele Menschen angewidert von einem gewalttätigen, Terror und Schrecken verbreitenden Islam, von einer solchen Religion und ihren Gläubigen abwenden? Es geht dabei nicht nur um die verwirrten und verirrten Jugendlichen, die im Namen Allahs terroristische Taten verüben. Es geht auch um die menschenunwürdigen Zustände in vielen islamischen Ländern, es geht um die öffentlichen Hinrichtungen, um Steinigungen, um grausame, mittelalterliche Praktiken, die von den gläubigen Muslimen viel zu selten verdammt werden. Es geht um die erbarmungslose und umfassende Benachteiligung der Frauen und der Andersgläubigen. Kurzum, es geht um die Negierung elementarer Menschenrechte im Namen einer großen Weltreligion. Das alles kann und darf kein Wohlwollen und keine Sympathien auslösen.
Islamophobie im heutigen Europa ist in erster Linie ein Ergebnis des Versagens muslimischer Eliten, ihren Glauben so zu leben und zu interpretieren, dass er mit Andersgläubigen oder Nichtgläubigen kommunizieren kann. Vor allem aber hat die Gewalt im Namen des Islam und des Koran zu einer großen Entfremdung zwischen Muslimen und Nichtmuslimen geführt. In dieser Entfremdung drückt sich in erster Linie Entsetzen aus. Und da die Sprache des Entsetzens nur eine Übersetzung für einen nicht oder nur schwer beschreibbaren Zustand ist, wirkt sie mal melancholisch, mal aggressiv, oftmals wenig kommunikativ. Uns allen gehen die Wörter aus. Nur fällt es schwer, das zu akzeptieren.
Mein Vater hat diese Zeiten nicht mehr erlebt. Kurz vor seinem Tod erfuhr er noch von einem deutschen Ex-Politiker, der ein besonders erfolgreiches Buch geschrieben hatte, in dem er Vaters Glaubensbrüder diffamierte. Oder kritisierte er sie nur, wie es auch mein Vater ein ganzes Leben lang getan hatte? Dieser nicht immer klare Trennstrich zwischen Kritik und Diffamierung war oft Gegenstand unserer Gespräche. Der Buchautor war nicht ironisch und arbeitete in seinen verqueren und polemischen Kulturbetrachtungen mit Assoziationen, die an Gentheorien erinnerten. Meinem Vater war dieses Denken gar nicht fremd. Er war fest davon überzeugt, dass es so etwas wie einen Volkscharakter gab, eine Mentalität, die zum Beispiel Türken, Deutsche und Araber voneinander unterschied, aber auch Bayern von Norddeutschen und Rheinländer von Sachsen. Was aber bedeuteten diese Unterschiede? Waren sie ein Hindernis für das Zusammenleben? Oder regten sie an, einander kennenzulernen? Brauchten wir diese „Rudelbildungen“ um den einzelnen Menschen, das Individuum zu verstehen? Für meinen Vater war folgender Koranvers richtungweisend: „ Ihr Menschen! Siehe, wir erschufen euch als Mann und Frau und machten euch zu Völkern und zu Stämmen, damit ihr einander kennenlernt.“ (Sure 49, Vers 13)
Das Erkennen und Kennenlernen gelingt nur, wenn Interesse und Neugier nicht hinter dem Schleier der Vorurteile und des Argwohns verschwinden. Erstickt nicht jedes Vorurteil das Interesse, die Neugier?
Manchmal hatte ich das Gefühl, dass sich mein Vater am Ende seines Lebens nach dem Deutschland der Sechziger und Siebziger Jahre sehnte, nach dem Land, dessen Menschen ihn, den Fremden, vorbehaltlos aufgenommen hatten. Die meisten Deutschen waren ihm ohne jedes Vorurteil begegnet. Er war für sie lediglich ein unbeschriebenes Blatt Papier gewesen. Und die wenigen Ausnahmen waren sofort zu erkennen, weil sie sich nicht hinter politisch korrekten Phrasen versteckten.
Die aktuellen Debatten aber waren ermüdend und wurden selten mit offenem Visier geführt. „Zu viele Fettnäpfchen sind nicht gut für einen geraden, aufrechten Gang“, pflegte mein Vater zu sagen. Ich konnte mir ihn kaum vorstellen als einen Gläubigen, der in einer Talkshow über seinen Glauben diskutiert, noch weniger als einen Publizisten, der sich als „Islamexperte“ in öffentliche Diskurse einmischt.
So hat er seine Trauer über die Zustände in der Gemeinschaft der Muslime und auch seinen Zorn gegen die „Glaubensbrüder“ mit ins Grab genommen, in die Stille.
Diese Stille wiederum hat mir geholfen, mich an die Begegnungen mit meinem Vater zu erinnern und dieses Buch zu schreiben, das zugleich Fiktion und Dokument, Erinnerung und Vermächtnis ist.


